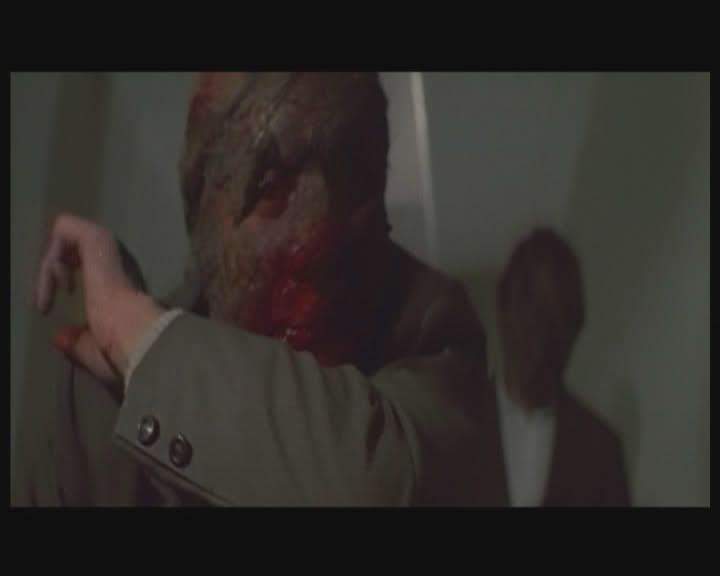Neulich den Soundtrack zu Walter Hills Streets of Fire als deutsche LP in einem Ein-Euro-Shop entdeckt, und zwei Tage später den Film in OmU von einer slowenisch-kroatischen DVD geguckt, die ich schon länger zu Hause herumliegen hatte. Nach 4 mehr oder weniger erfolglosen Versuchen innerhalb der letzten 10 Jahre, war es höchste Zeit Walter Hill endlich für mich zu entdecken. Ich muss gestehen, es hat geklappt. Auf dem Backcover der LP finden sich nachfolgende, in meinem Geburtsjahr von Walter Hill verfasste Zeilen zu seinem Film, und ich habe ihnen, außer ein paar Screenshots der gesichteten DVD, nichts hinzuzufügen.
STREETS OF FIRE, is, by design, comic book in orientation, mock-epic in structure, movie-heroic in acting style, operatic in visual style and cowboy-cliche in dialogue. In short: a rock ’n‘ roll fable where the Leader of the Pack steals the Queen of the Hop and Soldier Boy comes home to do something about it.
Since I much prefer films that make people remember things they’ve forgotten to those that try to discover something new, in STREETS OF FIRE, I tried to make what I would have thought was a perfect movie when I was in my teens – I put in all the things I thought were great then and which I still have great affection for, custom cars, kissing in the rain, neon, trains in the night, high-speed pursuit, rumbles, rock stars, motorcycles, jokes in tough situations, leather jackets and questions of honor. Weiterlesen “Streets of Fire (1984)” »
 Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…
Zu bedrohlichen Klängen erscheinen erste Credits wie weiße Gespenster im Schwarz des Bildes, dann mit einem tiefen Dröhnen und in zerfranstem Blutrot der Titel, während eine ängstliche Kinderstimme ein Gedicht ins Dunkel flüstert, rätselhafte Worte, eine düstere Prophezeiung: „…das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“ Jetzt ein Bild: Ein Fernseher zeigt einen alten Schwarz-Weißhorrorfilm: ein Irrer liegt auf einem Bett und schreit. Gebannt sitzt eine Gruppe Kinder auf einem Sofa davor, genießt den wohligen Schauer des Grusels… die Ungewissheit… die Möglichkeit, dass es so etwas vielleicht doch gibt… so etwas wovon die Erwachsenen behaupten, das gebe es gar nicht…
Huettners Film taucht völlig ein in jene Welt der kindlichen Phantasie, die den Erwachsenen, den ihrer Phantasie Entwachsenen, verschlossen bleibt, aber es geht hier nicht allein um die Phantasie, es geht um die Welt kindlichen Erlebens überhaupt, eines mystischen und träumerischen Welterlebens, wie es schon die Romantiker beschwören wollten.
Auf dem Nachhauseweg von dem Fernsehabend: die kleine Melanie fährt mit dem Fahrrad auf einen Schemen im Dunkel zu, eine durchsichtige ätherische Gestalt – und durch sie hindurch! Plötzlich ist da jedoch kein Schemen mehr, sondern eine ältere Frau liegt ganz körperlich vor Melanie unter deren Rad begraben und stammelt verstört: „Wer bist du? Du… bist so… kalt!“. Der Frau steht nun das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. „Was ist das für ein Kind?“ schreit sie immer lauter.
Bei einem Ausflug in die Berge mit ihren Eltern scheint der seltsame Vorfall vergessen, doch dann verirren sich diese und Melanie behauptet unvermittelt, sie wisse den Weg. Die ungläubigen Eltern folgen ihr zögerlich, aber Melanie führt sie immer höher, immer weiter Weg vom eigentlichen Ziel, hin zu einer einsam gelegenen Waldkapelle, ein Ort der ihnen seltsam vertraut ist: hier haben sie sich das erste Mal geküsst. Als sie den Weg ins Tal nicht mehr rechtzeitig vor Einbruch der Nacht finden, beschließen sie notgedrungen auf dem Berg in der Nähe eines Gletschers zu nächtigen. Doch: „das Eis wird auferstehen, eh sich die Stunde schließt…“
Momente eines ganz real-vertrauten Familienalltags gehen in diesem Film sukzessive über in eine mystische Welt der Zeichen und Wunder, der uralten Prophezeiungen und der gemurmelten Flüche. Bezeichnend ist eine Szene, in der Melanie auf eigene Faust wieder mit dem Zug in die Berge gefahren ist und sich in einer Höhle hinter der Kapelle versteckt. Ihr Vater ist ihr nachgereist und will sie nun zurückholen, doch vergeblich streckt er ihr die Hand entgegen, er ist zu groß um durch die Lücke in der Wand zu steigen. Als er sich klein machen will um sich durch eine Lücke im Gebälk zu zwängen, droht der Übergang zwischen Sakralbau und sakraler Natur einzustürzen. Er ist eben zu groß, zu vernünftig zu entzaubert um einen Zugang zur Welt des Geheimnisses zu finden, um die Welt noch zu verstehen, um zu erkennen, dass eben doch „Märchen und Geschichten, die wahren Weltgeschichten“ sind, wie Novalis einst geschrieben hatte. In bester Tradition der schwarzen Romantik ereilt denn letztlich auch diese erwachsenen Menschen der Vernunft der Fluch des Irrationalen und der Film endet schaurigschön in einer Katastrophe, angekündigt durch das unheilverkündende Schmelzen einer Silberglocke in einem verstaubten Archiv…
Der Fluch – BRD 1988 – 92 Minuten – Regie: Ralf Huettner – Drehbuch: Andy T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Joachim Müller – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Andreas Köbner – Darsteller: Dominic Raacke, Barbara May, Romina Nowack, Ortrud Beginnen, Gerd Lohmeyer, Barbara Valentin.

Als ich Tenebre dank eines guten Freundes zum ersten Mal als DVD-Beam auf der Kinoleinwand bewundern durfte, war das erst mein dritter oder vierter Film von Dario Argento, einem der Schutzheiligen des italienischen Genrefilms. Mein erster Argentofilm war bereits Jahre zuvor seine von Produzentenseite völlig zerstückelte Neuinterpretation des Phantom der Oper-Stoffes Il fantasma dell’opera (1998) gewesen, der zum damaligen Zeitpunkt unter Filmfans als schlechtester Argentofilm überhaupt galt (eine Einschätzung die sich inzwischen leider stark gewandelt hat). Ich liebte den Film. Ich erinnere mich noch wie mein Staunen sich zur Überzeugung formte, hier etwas völlig Neuartiges zu erblicken. „So hätten Filme im 19. Jahrhundert ausgesehen“ war in etwa mein Gedanke, wobei mich wohl vor allem die schwebende Kamera in ihren Bann zog. So genau weiß ich das leider nicht mehr (damals war ich wesentlich Filminteressierter als heute, und machte mir bei der Sichtung auch entsprechend mehr Gedanken), aber ich erinnere mich noch genau an das Gefühl einem Regisseur begegnet zu sein, der eine einzigartige Vision vom Kino hat. Wie zunächst Tarkowskij, Chaplin oder Kubrick, oder inzwischen auch Zulawski und Borowczyk, ist Argento für mich einer jener Filmemacher die dem Kino seine Möglichkeiten vor Augen führen, das Unergründliche zum Vorschein bringen, ohne dass es dadurch wirklich greifbarer werden würde. Die Tatsache, dass der Filmemacher die Welt mit der Kamera erschafft, durch den Sucher blickend, dass Film BILD ist, aber eben beweglich, sich verflüchtigend, paradox wie das Leben selbst, exemplifiziert sich für mich in der Welt dieser Voyeure, denn nichts anderes sind die meisten der größten Filmemacher für mich, jeweils auf ihre eigene Art. Der Blick des Voyeurs fetischisiert das Objekt, und durch die Kameralinse wird die Welt immer Fetisch, egal ob bei Bergman oder Spielberg. Das Wissen wollen, der Drang nach Erkenntnis, zeigt sich bei Argento im Beharren auf dem Blick, dem Blick in all seiner sinnlichen und intellektuellen, seiner umfassenden Form. Der Blick ins Unbekannte durchdringt die Gegenstände ohne dass er sie definiert. Erfahrung als Moment, als etwas das nur erlebbar, nicht begreifbar ist. Die Intensität speist sich hierbei aus der Phantasie. Denn wie der Fetisch selbst nur im Kopf des Betrachters zu sich selbst kommt, öffnen sich die Filme Argentos nur dem beharrenden Auge. Eine wiederholte Sichtung ist daher immer eine Steigerung der Wahrnehmung, der Komplexität, der Vielfalt des Blicks, wobei der Blick hierbei nicht nur das Auge als Organ, sondern das Auge als Körper meint. Weiterlesen “Geborgte Filme – endlich gesehen! #2: Tenebre (1982)” »

Mein erster Film von B-Film Legende Cirio H. Santiago hat mich gleich von Anfang an in seinen Bann gezogen. Final Mission ist einer von unzähligen Vietnamfilmen die in den 80ern gedreht worden sind, verbindet hierbei aber zusätzlich noch Elemente des Polizeifilms mit einer Rachegeschichte. Im letzten Drittel geht es dann um ein Quasi-Remake des 2 Jahre zuvor entstandenen First Blood. Viel geklaut möchte man da vielleicht sagen, und in der Tat äußern sich die meisten Kommentare, über die ich im Internet gestolpert bin, hierzu auch ziemlich abfällig. Aber die Kreuzigungsszene ist in der Geschichte der Malerei auch schon tausendfach abgebildet worden, und die Notenskala lässt sich in der Musik ebenso endlos variieren. Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen habe ich prinzipiell nicht das Geringste gegen Plagiate einzuwenden. Originalität ist was man daraus macht, und wie beim Jazz ist Improvisation manchmal entscheidend. Das „Wie“ ist also wieder einmal wichtiger als das „Was“. Jedenfalls in meiner Welt. Weiterlesen “Final Mission (1984)” »
Endlich mal wieder ‚was markiges! Für alle diejenigen, die nicht (oder nicht bewusst) in den 80ern aufgewachsen sind ist Road House die Offenbarung schlechthin. Denn hier wird gnadenlos aufgezeigt, wie das Zeitalter von Dieter Bohlens größten Erfolgen auf der anderen Seite des Atlantiks aussah.

© 1989 Silver Pictures
Während in Deutschland die Grenzöffnung bevorsteht kloppt sich Patrick Swayze in einer abgehalfterten US-Kleinstadt mit deren informeller Obrigkeit. Da werden Eier blau gefärbt und Poseur-Patrick reißt in einer Art goldenen Griff der Filmgeschichte einem Rivalen die Kehle aus dem Halse. Klitschnass torkelt er noch ein wenig durchs Bild bis auch dem letzten Zuschauer klar wird: Es ist kein Schweiß, sondern Testosteron pro Analysis, das dem Protagonisten aus den Poren trieft. Die Antagonisten sparen natürlich auch nicht mit diesem göttlichen Hormon, so dass es während des gesamten Films hin und wieder zu Konflikten kommt. Im Laufe der 114 Minuten werden diese aber alle gelöst.
Übrigens löst auch Peter Griffin von Family Guy in S08E04 – ‚Brians Got a Brand New Bag‘ seine Probleme galant in Road House-Manier.
Weiterhin wird gemunkelt, dass Rainer Brandt für die Synchronisation dieser Milieustudie eine nicht näher genannte Summe geboten haben soll, dann aber von Ulrich Gressieker einen Tritt aufs Nasenbein bekam.

Die eine bizarre Schönheit ausstrahlende Eis- und Steinlandschaft einer winterlichen Ostseeinsel gibt in Schlingensiefs drittem Spielfilm die Kulisse für ein Drama von archaischen Ausmaßen ab. Anders als in seinen späteren, auf bestimmte politische Ereignisse Bezug nehmenden Filmen, lotet Schlingensief hier in mythischem Erzählgestus die (Un-)Tiefen des menschlichen Bewusstseins mit all seinen Ängsten und Begierden aus. Ein pathetischer Erzähler führt, düstere Prophezeiungen raunend, durch die surreale Urspungswelt, die sich der Film irgendwo im phantastischen Niemandland zwischen Lewis Carrolls „Wunderland“ und Caspar David Friedrichs düstersten Bildern entwirft.
Udo Kier verkörpert hier als finsterer Baron Tante Teufel einmal mehr das Böse auf seine charmant kokettierende Weise: „Ich…ich habe den Teufel gesehen… Und er war schöner als ich!!!“ (schluchzt laut auf). Die damals noch so gut wie unbekannte Tilda Swinton, die zur Drehzeit eine kurze Liaison mit Regisseur Schlingensief hatte, kann in ihrem zweiten Spielfilm überhaupt bereits als die ätherische und rätselhafte Elfe glänzen, die sie in verblüffend ähnlicher Weise später auch in Jarmans „The Last of England“ und anderen Filmen verkörpern sollte.
Eine Handlung im klassischen Sinne gibt es in diesem Film nicht. Vielmehr verbindet „Egomania“ in assoziativer Weise Versatzstücke und Archetypen großer Menschheitsmythen, von Ödipus über Jesus und Macbeth bis zum fliegenden Holländer und Dracula. Dabei gelingt es dem Film jedoch auf vielschichtige und – nicht zuletzt auch dank der ausgezeichneten Kameraarbeit – oft poetische Weise die menschliche Urkatastophe Liebe in zugleich faszinierende und verstörende Bilder zu fassen: Liebe zu sich, zu anderen, zu Geld, zu Macht und zum Tod selbst. Wagnersches Pathos geht hier eine ganz ungezwungen wirkende Liaison mit augenzwinkernder Ironie ein.
Am Ende scheitert die Liebe in jeder Hinsicht und wir dürfen uns dem kultivierten und zugleich ironisch reflektierten Weltschmerz hingeben, wenn der Erzähler angesichts der Tragödie nicht müde wird zu insistieren: „Ein anderes Weltende wird es nicht geben!“
Egomania – Insel ohne Hoffnung, BRD 1986, 84 Min, Regie: Christoph Schlingensief, Kamera: Dominikus Probst, Mit: Tilda Swinton, Udo Kier, Uwe Fellensiek, Anne Fechter.
Hinweis: Die Nummerierung der Filme folgt lediglich der Reihenfolge der Einträge. Die Gesamtauswahl von 100 Filmen ist nicht redaktionell abgestimmt, sondern eine im Laufe der Veröffentlichung zufällig entstehende Zusammenstellung, die sich aus den Einzelbeiträgen und persönlichen Vorlieben der Teilnehmer ergibt.

Der Traum vom großen amerikanischen Kino der übergroßen Archetypen. In Frankreich ist es nicht nur genreaffinen Filmemachern eine Gewohnheit – eigentlich schon eine französische Kinotradition – geworden, ihn zu träumen oder mit ihm zu spielen. In Deutschland wird er meist eher von eisenharten Produzenten denn Regisseuren geträumt. Wenn er dann einmal von einem Filmemacher geträumt wird, muss alles da sein. So wie hier: Der verbitterte, alternde Sheriff, der alles und jeden verachtet und in seinem eigenen Schnapstümpel ertrinkt. Der junge, unerfahrene Deputy, der mit dem Zynismus und der Brutalität seines Chefs nicht zurechtkommt. Die einsame und resignierte Ehefrau des Sheriffs, die eine Affäre mit dem Deputy unterhält. Das von zuhause ausgerissene Mädchen in Not, dass zum Auffänger, Sündenbock und Versuch(ung)sobjekt dieser drei nicht minder notleidenden Existenzen avanciert. Und das heruntergekommene, alte Polizeirevier am Rand der Stadt, in einem alten Lagerhaus, in einem Niemandsland leerer Häuser und dreckiger Straßen. Hier kommt das dunkle Gesicht von John Wayne und die stereotype Seite des „new Hollywood“ zum Vorschein.
Und, weil wir hier in dem kochenden, superassigen Klaus Löwitsch nicht nur einen deutschen Jack Nicholson sondern auch einen bei aller markigen Selbstdarstellung und monströsen Inszenierung seitens der Regie immer ein wenig zu echt wirkenden, von Frustration und Lebensverschwendung ermüdeten deutschen Beamten sehen, der die Nase voll hat.

Das kann, hoffentlich, zu der Erkenntnis führen, das frustrierte Beamte und vor allem frustrierte Polizisten kein Phänomen sind, dass exklusiv dem amerikanischen Kino angehört und auch keines, dass im deutschen Kino nur dann auftauchen kann, wenn es ein amerikanischer Film vormacht. Die Bewunderung für Regisseure wie Sidney Lumet, Francis Ford Coppola und Martin Scorsese trieft hier zwar aus allen Poren, gleichzeitig wird aber auch gefiltert – durch jenen Abstraktions-Filter, mit den das französische Kino der 60iger und 70iger Jahre bereits das „Amerikanische“ beäugt hat und mit einem sicheren Gespür dafür, wo die Faszination enden und einer kulturell unterfütterten Wirklichkeit Platz machen muss. Und die hält in KAMINSKY sehr schnell einen deftigen Einzug nach dem prototypischen und irritierend streng konstruierten Auftakt, der seine treffsicher gewählten Klischees mit beachtlicher Unverfrohrenheit platziert.
In besagter Eröffnungsszene schlägt Kaminsky mit von der Brotzeit noch fettigen Händen in einer schäbigen Kneipe einen Drogendealer zusammen, als Gefälligkeit für den vor Angst zitternden Wirt, dessen Sohn apathisch im Drogenrausch dem Geschehen folgt. Eine Western-Szene ist das, ohne jede Frage. Aber sie gibt nicht den Ton des übrigen Films vor, sondern bemerkt mit leiser Süffisanz, wie unmöglich sich der assoziative Kreislauf zwischen Publikum – Öffentlichkeit, „Tough guy“ – Polizist und Kino – (medialer) Wirklichkeit aufbrechen lässt – und dass man sich gegen seine Unzerstörbarkeit nicht wehren sollte. Wenn der Film wenig später sein fiebriges Kammerspiel in die Wege leitet, erkennen wir, warum wir uns gewehrt haben, gegen diese Klischees. Weil wir sie so direkt wiedererkannt haben, als Bausteine aus anderen Filmen und damit aus einer anderen Wirklichkeit, was uns nur daran hindern kann, hier, in KAMINSKY, eine eigene Wirklichkeit zu finden.

Aber wir bekommen sie, auch wenn Michael Lähn hier einen dieser Filme gedreht hat, bei denen man mit konstant zunehmender Unsicherheit darüber grübelt, ob man sich eher ohne Scham und ungehemmt an der asozial-schmierigen Soziopathen-Show des Protagonisten ergötzen soll oder mit feierlichem Ernst der Stimme der wirklichen, deutschen Wirklichkeit hinter dieser filmischen, amerikanischen Wirklichkeit lauschen soll. Der Film ignoriert dieses Grübeln mit Nonchalance und steigert die Widersprüche seines kleinen Universums bis zum Exzess. Ohne dabei den Bezügen zur wirklichen Wirklichkeit ein Gesicht, ein griffiges Profil zu geben. Nur am Ende, als wir dem negativen Höhepunkt dieser angestauten Frustrationen und dieses Zynismus, der Vergewaltigung des Mädchens, aus Dieters Perspektive in der dunklen Toilette beiwohnen, sie also nur mithören, da verflüchtigt sich die filmische, postmoderne Wirklichkeit für einen Moment und die zeitgenössische Wirklichkeit quetscht ihr verkatertes Gesicht durch den Rahmen. Das allerdings bevor wir nach dem finalen Duell, der Konfrontation, der Eskalation völliger Katharsis, das Revier verlassen, dass in der Morgendämmerung wie ein friedliches Monument daliegt, wie ein Western-Saloon. Wenn wir verschiedene, uns bekannte filmische Wirklichkeiten und die Polizisten und Gangster, denen wir dort begegnet sind, durcheinander bringen oder nicht erfolgreich vor unseren Augen verschmelzen können, denken wir in diesen kurzen Momenten des Leerlaufs vielleicht kurz daran, dass sie auch nur Menschen sind und flüchten uns in die wirkliche Wirklichkeit. Aber sobald Ordnung einkehrt in der filmischen Wirklichkeit, wollen wir keine Menschen, sondern Archetypen. Kaminsky ist ein zünftig-deutscher und demzufolge natürlich besonders teutonischer Archetyp, der immer darauf gewartet hat, seine filmische Wirklichkeit zu bekommen. Dass er dabei eine amerikanische Hilfestellung in Anspruch genommen hat, sollte man ihm nicht negativ anrechnen. Dadurch würden sich die beiden Wirklichkeiten unter dem Vorzeichen deutscher Kultur-Identifikation mit amerikanischen Attributen nur wieder in die Haare kriegen – und das wäre doch schade.
Kaminsky – BR Deutschland 1984 – 80 Minuten – Regie und Drehbuch: Michael Lähn – Produktion: Klaus Sungen – Kamera: Jörg Seidl – Schnitt: Camilla Bernetti – Musik: Roberto C. Detree – Darsteller: Klaus Löwitsch (Rolf Kaminsky), Alexander Radszun (Dieter Stecker), Beate Finckh (Renate), Hannelore Elsner (Nicole Kaminsky)
Hinweis: Ursprünglich war dieser Text für die „100 Deutsche Lieblingsfilme“-Reihe gedacht. Warum er dort nicht erschien, ist hier nachzulesen.

Vorwort:
Wer kennt das nicht: Da ist man bei einem Freund zu Besuch, oft filmbegeistert wie man selbst, und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Filme über Filme, alles will man sehen, und dann wird gebettelt: „Den muss ich uuunbedingt sehen… bitte, bitte, bitte… kriegst ihn auch bald wieder zurück…“. Die meisten Freunde sind leichtgläubig (deshalb sind sie wahrscheinlich auch Freunde), und schon ist es geschehen. Man nimmt den/die Film(e) mit nach Hause und dann? Exakt. Sie verstauben für Monate in der Ecke. Nicht dass man sie nicht sehen wollen würde. Aber man muß gerade ins Kino, dann läuft noch eben was im Fernsehen, und die ganzen anderen geliehenen Sachen müssen ja auch noch irgendwann gesichtet werden. Schließlich gibt es nicht nur Freunde, sondern auch naive Bekannte, Videotheken, Büchereien, und sonstige Modalitäten die der Filmaneignung dienlich sind. Auch wenn as mit den Videotheken oder Büchereien manchmal ganz schön teuer werden kann…
Um also mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, und einige der Filme die bei mir rumliegen endlich wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuführen zu können, habe ich diese Rubrik ins Leben gerufen. Ein kleiner Anreiz vielleicht, die lange Liste abzuarbeiten und nebenbei auch noch etwas zu Papier zu bringen.
Den Anfang macht Umberto Lenzis „Großangriff der Zombies„, weil ich den gerade eben geguckt habe.
Incubo sulla città contaminata
(Umberto Lenzi / Italien, Spanien, Mexiko / 1980)

Die Verwirrung beginnt schon mit dem Titel: „Nightmare City“, „La invasión de los zombies atómicos“, „City of the Walking Dead“. Laut imdb eine italienisch-spanisch-mexikanische Koproduktion, habe ich zunächt Schwierigkeiten zu entscheiden in welcher Sprache ich den Film nun schauen will. Auf der DVD stehen mir (leider) nur 2 Optionen zur Verfügung: Deutsch oder Englisch. Da ich ein Hardcorecineast und Sparchenfetischist bin, sprich, mir immer alle Filme wenn irgend möglich im Original mit Untertiteln ansehen will, schaue ich bei besagter Internetseite nach der Orginialsprache: Italienisch und/oder Spanisch. Tja, was macht man da…? Entscheide mich schließlich für Englisch, nachdem ich in eine Dialogszene hineingeschaut habe, und mir sicher bin, dass einige Schauspieler in den Szenen definitiv Englisch sprachen oder zumindest versuchten diese Sprache zu imitieren. Außerdem hört sich die deutsche Synchro an derselben Stelle doch um einiges trashiger an, und viele italienische Filme wurden zu der Zeit bekanntlich auch für den englischsprachigen Markt gedreht. Mit einem letzten Gedanken an Mel Ferrer versuche ich die Entscheidung für die englische Tonspur zu rechtfertigen, und schon geht es los.

Vorspann ist schon mal Spitze. Tolle Musik (oh ja: Stelvio Cipriani!), und Aufnahmen von Panoramen und Straßenschluchten einer Großstadtmetropole. Atmosphärisch gelingt Lenzi hier schon die perfekte Einstimmung auf das kommende Geschehen. Ciprianis düstere Synthesizerklänge, getragen aber doch treibend, kombiniert mit anonymen Industriebauten versetzen mir ein wohliges Gruseln, und vermitteln bereits eine Ahnung von der drohenden Apokalypse. Ok, ganz neu ist das nicht. Irgendwie wirkt vieles bekannt, vor allem wohl aus George Romeros Dawn of the Dead (1978). Aber gut geklaut ist für mich trotzdem die halbe Miete. Tarantino ist schließlich nicht der Einzige der damit Kohle scheffelt. Die Handlung ist schnell erzählt: Ein Virus hat wohl von einer handvoll Menschen Besitz ergriffen, die zu Beginn des Films in einem anonymen Flugzeug in einer nicht näher benannten amerikanischen Stadt landen. Es gelingt diesen „Zombies“ (später stellt sich heraus, dass es doch „lediglich“ radioaktiv verseuchte Menschen sind) in die Stadt einzudringen, wobei sie eine blutige Spur der Gewalt hinterlassen. Sie scheinen sinnlos alles zu attackieren was sich bewegt, wobei im Verlauf des Films auch klar wird, dass sie für ihr Überleben ständig frisches Blut benötigen. Also eher eine Mischung aus Vampir und Zombie, denn laufen, prügeln, autofahren und mit Maschinengewehren um sich schießen können sie auch. Der Protagonist, der die Invasion auf dem Flughafen miterlebt hat, ist Reporter, darf aber nicht berichten. Das Militär übernimmt, jedoch soll bei den Bewohnern der Stadt keine Panik ausgelöst werden. Natürlich kommt es wie es kommen muß. Die Situation gerät mehr und mehr außer Kontrolle, da die Infizierten praktisch unverwundbar sind und sich beliebig vermehren können.
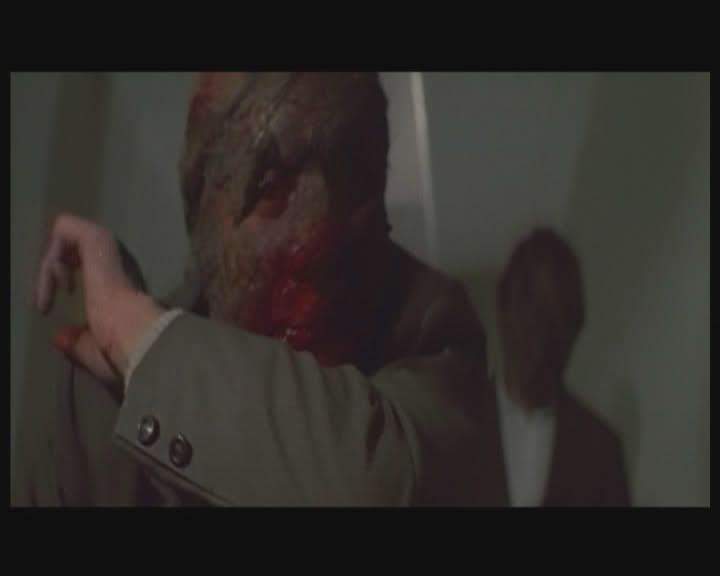
Natürlich ist das Ganze nicht vollkommen ernstzunehmen. Die Dialoge sind meist hahnebüchen, das Make-up und die Splatterszenen grotesk, von stringentem Handlungsaufbau oder gar erzählerischer Kohärenz ist nichts zu spüren. Trash vom Feinsten könnte man also meinen. So einfach ist es jedoch nicht. Umberto Lenzi ist kein Amateur, versteht zumindest in einigen Aspekten sein Handwerk ausgezeichnet, und in seinen Filmen findet sich neben aller Übertreibung auch einiges an Ambivalenz was gesellschaftliche Zustände anbelangt. So auch in „Großangriff der Zombies“. Nicht zuletzt wegen der großartigen Schlußwendung (die ich an dieser Stelle nicht verraten will) rückt der Film in die Nähe von traumähnlichem (italienischen) Genrekino à la Argento, Fulci oder Bava. Dass es Lenzi nicht um einen traditionellen Realismusbegriff geht ist schon relativ bald klar. Realitätsfern ist der Film jedoch bei weitem nicht. Das Szenario einer Invasion von Außen war während des kalten Krieges ein beliebter Topos, doch Fulci gibt dem teilweise durchaus reaktionären Gestus seines Films einen interessanten Twist, wenn er das Bodysnatcher-Motiv leicht umfunktioniert. Denn wie es an einer Stelle des Films explizit formuliert wird: Die infizierten Lebewesen sind eindeutig keine Aliens, sondern Menschen wie du und ich. Und infiziert wird jeder der mit ihnen in Berührung kommt. Der Film trägt seine Botschaft denn auch über weite Strecken der Handlung vor sich her, und Fulci lässt seinen Protagonisten und dessen Freundin, die wir den ganzen Film über auf der Flucht beobachten, in einigen Szenen tatsächlich innehalten, nur um dem Zuschauer die (vorgeschobene) Argumentation wiederholt vorzuhalten: Die Menschen an sich sind schlecht (sprich infiziert), weil sie machtgierig sind, weil sie Fortschritt mit Technologie verwechseln, und weil sie sich schon längst von ihrer wahren Natur entfremdet haben. Der Zombie als natürliche Folge der (eingeschlagenen) Evolution. Neu ist das nicht, aber es funktioniert.

In Verbindung mit zahlreichen surreal anmutenden Sequenzen, die in den gelungensten Momenten an Fulcis „The Beyond“ (der tatsächlich später entstanden ist), besagten Romero und eben auch an die Traumwelten aus Argentos Suspiria und vor allem Inferno erinnern (besonders eindrucksvoll: Der Endkampf im verlassenen Vergnügungspark auf den Achterbahnschienen!), entsteht eine doch sehr eigenwillige Horrorfabel. Wer einen traditionell ernsthaften Genrefilm erwartet, wird aber wohl eher enttäuscht. Wie gesagt, kann man das natürlich auch alles lächerlich finden, und sich an den vorgeblichen Peinlichkeiten der Inszenierung ergötzen. Persönlich finde ich die Inszenierung in letzter Konsequenz (vor allem angesichts des Endes) jedoch durchaus agemessen und im Sinne einer spezifischen Reflektion über den Zustand der Welt auch kohärent. Was mir anfangs oft übel aufstieß oder einfach nur auf die Nerven ging, macht am Ende Sinn. Für mich war „Großangriff der Zombies“ eine lohnende und eindrucksvolle Erfahrung. Vielleicht lese ich in den Film zuviel hinein, und stehe in Wirklichkeit einfach nur auf die Kombination von Authentizität vermittelnder Handkamera und phantastischem Sujet, weil sich in diesem scheinbaren Widerspruch für mich automatisch zahlreiche Reflexionsebenen ergeben die die körperliche Erfahrung zwangsweise mit der psychischen verbinden, auch weit über den Film hinaus (siehe hierbei die beiden meiner Meinung nach großartigen Kannibalenfilme von Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust und Ultimo mondo cannibale). Man könnte das als transgressiv bezeichnen – oder einfach von „Der Zauberer von Oz meets Jack the Ripper“ sprechen (mit einer Prise Ed Wood). Gegensätzliches, und scheinbar Unvereinbares ergibt oft die interessantesten Kombinationen.

Der innere Widerspruch der sich in „Großangriff der Zombies“ aus ausgestelltem voyeuristischem Exzess und einer offensichtlichen, im Grunde vielleicht banalen Gesellschaftskritik ergibt, erzeugt einen Widerstand der reinen Oberfläche, eine Öffnung zugunsten eines möglichen Phantasmas. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass der Film für mich in der Auseinandersetzung unheimlich gewinnt. „Großangriff der Zombies“ ist ein Musterbeispiel für die in der bürgerlichen Kritik oft verleugneten Qualitäten des Genrekinos, nicht nur im Italien der 60er, 70er oder 80er Jahre (genausogut könnte man manchen „Unterhaltungsfilm“ der NS-Zeit, oder das frühe Stummfilmkino – vor der Herausbildung der künstlerischen Ambitionen der 20er Jahre – als Beispiel heranziehen). Man könnte noch einiges über Lenzis permanente Fetischisierung des Körpers schreiben, die ent/subjektivierung des Blicks, oder die Ökonomie von Objekten. Ob es für einen guten Film auch einen guten Regisseur braucht weiß ich nicht. Aber dass ich noch viel mehr von Umberto Lenzi sehen will steht für mich nun eindeutig fest.

„The Thing“ – so schlicht und bescheiden sich dieser Filmtitel auch anhört, so problematisch und hintergründig wird er, wenn man ihn auf dem Hintergrund der Philosophiegeschichte betrachtet. Was ist das eigentlich, ein Ding, ein Etwas überhaupt, unausgemacht ob Mensch, Tier, Pflanze oder Gestein, Gegenstand oder Eigenschaft, Realität oder Einbildung? Kann man dieses „Etwas=x“ definieren, allgemeine Aussagen darüber treffen, die dann auf jedes Etwas und seine Verhältnisse zu anderem etwaigen in jedem Falle zuträfen? Dies war der Versuch der klassischen Metaphysik, spätestens seit Aristoteles, der sein Etwas, seine Ousie, jedoch nicht definiert haben, sondern in einer paradigmatischen Wirklichkeit ideal verkörpert sehen wollte, von der aus die anderen, abgeleiten Wirklichkeiten dann analog bestimmbar wären. Doch nicht nur die Philosophie, auch die Theologie laborierte immer am Ding, genauer gesagt an seiner Einheit, Zweiheit oder Dreiheit. Inwiefern ist Gott ein Ding – eine Ousie=Ding – und doch auch drei (Hypostasen = Dinge), inwiefern der Christus ein doch immer auch und ebenso auch wieder nicht zwei Dinge?
Was soll es also genau sein, dieses Etwas oder Ding? Schließlich ist auch ein Unding ein Ding, eben ein Etwas, genau wie jede Art von Phantasiegebilde oder auch jede Art von Nichts: Das Nichtvorhandensein von Geld etwa, Schulden oder Zahlungsunfähigkeit, können ein eminent wirksames und verheerendes Ding sein, ebenso wie das Nichtvorhandensein von Zeit, Kraft, Witz oder auch Verstand. So kam man in der idealistischen Tradition, spätestens aber mit Kant, auf den genialen Kunstgriff, daß Aussagen über das Etwas als Etwas, das ens qua ens, als solche unmöglich sind, da dieser Begriff sich letztlich in seiner Überabstraktion selbst aufhebt: Möglich sind Aussagen über das Etwas oder Ding als solches nur insofern es Objekt ist, also Erkenntnisgegenstand einer Subjektivität: Das gesuchte Ding oder etwas ist also immer das Objekt, der Gegenstand überhaupt auf den wir uns erkennend und wollend beziehen.
Weit entfernt von philosophischer Naivität scheint die filmische Bearbeitung des Themas diese Erkenntnis immer vorauszusetzen, so daß man Aristoteles fast ein wenig bemitleiden muß, daß er nicht einfach ins Kino um die Ecke gehen und sich seine Ousie, sein Etwas, sein Ding von Christian Nyby und John Carpenter hat erklären lassen. Ersterer setzt nämlich schon im Titel („The thing from another world“) die fundamentale Differenz zwischen diesseitigem Subjekt und andersweltlichem Ding, also jenseitigem Objekt der Erkenntnis voraus, während letzterer, in Wahrung des Hegelschen Satzes vom Bewußtsein, diese Differenz (trotz der Ignoranz deutscher Verleiher) bereits wieder eingezogen hat und voraussetzt, daß jede erkennende Subjektivität das Ding nur von sich unterscheidet, indem sie es gleichzeitig auf sich bezieht. Hier tut sich also bei allem grundsätzlichen Konsens in der Herangehensweise bereits eine metaphysische Spannung zwischen beiden Regisseuren und Epochen (1951 und 1982) auf, die in der lebensweltlichen Vermittlung, der konkreten filmischen Umsetzung des metaphysischen Themas geradezu zu diametral auf den Kopf gestellten Verhältnissen führt, zu einer totalen Umpolung im wahrsten Sinne des Wortes: Siedeln die fünfziger Jahre die Geschichte nämlich oben, auf dem von den Amerikanern kontrollierten (aber auch an Rußland grenzenden) Nordpol an, wählt der Carpenter der frühen Achziger das unten, die Einsamkeit und Abgeschiedenheit des Südpols. Bedenkt man die unterschiedlichen metaphysischen Vorzeichen ist dies sicher alles andere als bloßer Zufall: Wie gesehen setzte Nyby in der titularen Gestaltung des von ihm vorgestellten Ding- oder Objektbezuges mit der radikalen Differenz ein. Das Objekt oder Ding ist das ganz andere, dem Geist äußerliche, welches ihn aber, umso widerständiger und äußerlicher es ihm erscheint, desto mehr anspornt, es zu überwinden und es sich symbolisierend und organisierend, erkennend und handelnd anzueignen. In den Fünfzigern bildet die Menschheit eine Einheit in ihrem Erkenntnis- und Organisationsstreben, eine Einheit, die auch durch das ihr von oben entgegenkommende, photosynthesefähige und gefühllose „Rübenwesen“ (die humoristischen Einlagen des Journalisten entsprechen ganz dem heiter-zielbewußten Optimismus des aneignungssicheren Dingbezugs) aus dem Weltall nicht ernsthaft in Frage gestellt wird, sondern sich nur innerlich bewähren muß: Ist die Spannung zwischen Erkennen und Organisieren, Wissenschaft und Militär erst ausgefochten, dann hat eben in diesem Fall der erkenntnishungrige Professor das Nachsehen, doch ist ganz klar, daß das Ding überwunden und angeeignet wird. Letztlich kann die ganze Geschichte den Gang der menschlichen Angelegenheiten nicht in Frage stellen, sondern wird zum bloßen Katalysator, der der Menschheit einen neuen Sieg und unseren Helden Cpt. Hendry und der kessen Sekretärin Nikki die erwünsche Hochzeit bringt.
Ganz anders jedoch der Objektbezug bei Carpenter: Hier erscheint der Mensch verzweifelt an der Aneignung des Außen und ganz Zurückgeworfen in das Innen, nicht oben, auf dem Nordpol, dem Himmel entgegen, sondern unten, abgeschieden in der Antarktis, konfrontiert mit etwas, was seit tausenden von Jahren im Erdboden schlummert, genauer gesagt wohl in den Tiefen des eigenen Selbst. Nicht die amerikanische Gruppe als Speerspitze der Menschheit selbst stößt hier auf das Ding, sie muß vielmehr im Nachhinein mit etwas fertig werden, was Generationen vor ihr längst entfesselt haben und an dessen Aneignung sie verzweifelt und zugrunde gegangen sind. Das Ding ist daher auch kein dem Menschen überlegenes Wesen eigenen Rechts, vielmehr nichts weiter als ein hinterhältiger, die menschlichen Zellen von innen befallender und schließlich klonender Retrovirus, der sich überall um uns herum und in einem jeden von uns verbergen könnte.
Will die Menschheit hier weiter kommen, so jedenfalls nicht in der erkennenden oder handelnden Aneignung des Außen, sondern höchstens in der Transformation des Innen. Verzweifelt am Oben und Außen, wendet sich die Subjektivität in ihrem Ding bezug also nach unten, zum Innen, doch allerdings nur um festzustellen, daß dieses, verobjektiviert und zum Gegenstand geworden, ebenfalls Ding und damit dem subjektiven Selbst äußerlich werden muß: Niemand weiß genau, ob er selbst, sein Freund, Zimmer- oder Bettgenosse den Virus bereits im Blut haben, ob wir uns also selbst sehen oder nur unseren Übergang zum Ding, einem Etwas, von nicht nur nichts wissen, sondern das wir vor allem auch keinesfalls kontrollieren können, nicht einmal mit allem Sprengstoff, der sich in der antarktischen Militärbasis finden läßt. Aus dieser überpessimistischen metaphysischen Perspektive bleibt dem Regisseur wie dem Zuschauer abschließend nur die bange Frage: Wo warst Du? Wo war ich? Was bleibt, als abzuwarten, ob wir Ich bleiben oder Ding werden?
Bin gerade etwas auf dem Tatort-Trip und versuche mehr über die wunderbar sleazig klingende Folge Der gelbe Unterrock aus dem Jahr 1980 herauszufinden, die nach ihrer Erstausstrahlung im Giftschrank des SWR verschwunden ist. Generell faszinieren mich die Tatort-Folgen aus den Achtzigern, schon allein wegen den so merkwürdig fremd und fern wirkenden Bildern aus der „alten“ BRD. Zum Beispiel im Schimanski-Tatort Das Mädchen auf der Treppe, wenn die Kamera über den Tatort schwenkt und sich hinter den klobigen Einsatzwägen und den grauen Mietshäusern vor einer brachen Wiese die riesige Zeche aufbaut. Oder das blinkende, alte Bierschild im Hintergrund der Kneipenszene. Überhaupt wirkt das alles gar nicht so wie die meisten Fernsehfilme, die man heute so sieht, sondern viel filmischer, näher am Kino. Und das nicht nur, weil der Soundtrack wie bei Michael Mann oder Kathryn Bigelow von Tangerine Dream stammt:
(Über das Benutzerprofil des Users bei Youtube findet man noch eine Zusammenstellung des Tatorts Miriam von 1983, bei dem die Musik ebenfalls von Tangerine Dream stammt.)
Übrigens zeigt 3sat nächsten Sonntag (also den 23. August) die Folge Reifezeugnis von Wolfgang Petersen mit Nastassja Kinski aus dem Jahr 1977. Und Dominik Grafs Jubiläumstatort Frau Bu lacht wird am 24. August im SWR und am 10. September im WDR wiederholt.