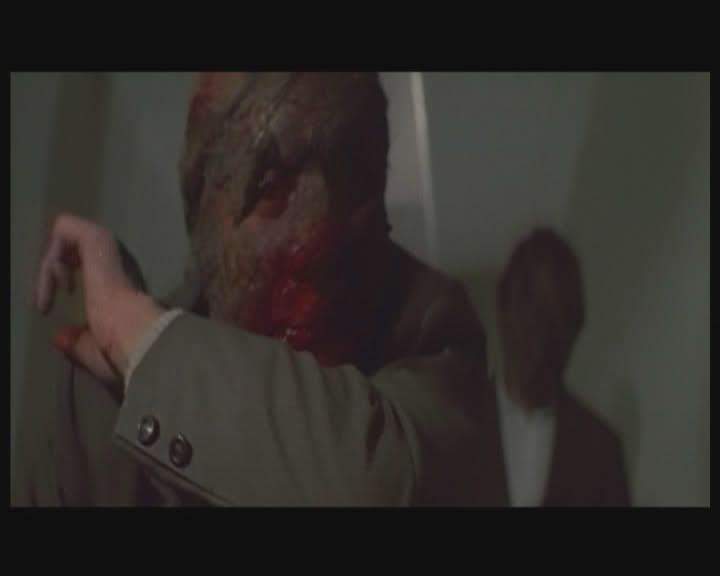Vorwort:
Wer kennt das nicht: Da ist man bei einem Freund zu Besuch, oft filmbegeistert wie man selbst, und man kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Filme über Filme, alles will man sehen, und dann wird gebettelt: „Den muss ich uuunbedingt sehen… bitte, bitte, bitte… kriegst ihn auch bald wieder zurück…“. Die meisten Freunde sind leichtgläubig (deshalb sind sie wahrscheinlich auch Freunde), und schon ist es geschehen. Man nimmt den/die Film(e) mit nach Hause und dann? Exakt. Sie verstauben für Monate in der Ecke. Nicht dass man sie nicht sehen wollen würde. Aber man muß gerade ins Kino, dann läuft noch eben was im Fernsehen, und die ganzen anderen geliehenen Sachen müssen ja auch noch irgendwann gesichtet werden. Schließlich gibt es nicht nur Freunde, sondern auch naive Bekannte, Videotheken, Büchereien, und sonstige Modalitäten die der Filmaneignung dienlich sind. Auch wenn as mit den Videotheken oder Büchereien manchmal ganz schön teuer werden kann…
Um also mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, und einige der Filme die bei mir rumliegen endlich wieder ihren rechtmäßigen Besitzern zuführen zu können, habe ich diese Rubrik ins Leben gerufen. Ein kleiner Anreiz vielleicht, die lange Liste abzuarbeiten und nebenbei auch noch etwas zu Papier zu bringen.
Den Anfang macht Umberto Lenzis „Großangriff der Zombies„, weil ich den gerade eben geguckt habe.
Incubo sulla città contaminata
(Umberto Lenzi / Italien, Spanien, Mexiko / 1980)

Die Verwirrung beginnt schon mit dem Titel: „Nightmare City“, „La invasión de los zombies atómicos“, „City of the Walking Dead“. Laut imdb eine italienisch-spanisch-mexikanische Koproduktion, habe ich zunächt Schwierigkeiten zu entscheiden in welcher Sprache ich den Film nun schauen will. Auf der DVD stehen mir (leider) nur 2 Optionen zur Verfügung: Deutsch oder Englisch. Da ich ein Hardcorecineast und Sparchenfetischist bin, sprich, mir immer alle Filme wenn irgend möglich im Original mit Untertiteln ansehen will, schaue ich bei besagter Internetseite nach der Orginialsprache: Italienisch und/oder Spanisch. Tja, was macht man da…? Entscheide mich schließlich für Englisch, nachdem ich in eine Dialogszene hineingeschaut habe, und mir sicher bin, dass einige Schauspieler in den Szenen definitiv Englisch sprachen oder zumindest versuchten diese Sprache zu imitieren. Außerdem hört sich die deutsche Synchro an derselben Stelle doch um einiges trashiger an, und viele italienische Filme wurden zu der Zeit bekanntlich auch für den englischsprachigen Markt gedreht. Mit einem letzten Gedanken an Mel Ferrer versuche ich die Entscheidung für die englische Tonspur zu rechtfertigen, und schon geht es los.

Vorspann ist schon mal Spitze. Tolle Musik (oh ja: Stelvio Cipriani!), und Aufnahmen von Panoramen und Straßenschluchten einer Großstadtmetropole. Atmosphärisch gelingt Lenzi hier schon die perfekte Einstimmung auf das kommende Geschehen. Ciprianis düstere Synthesizerklänge, getragen aber doch treibend, kombiniert mit anonymen Industriebauten versetzen mir ein wohliges Gruseln, und vermitteln bereits eine Ahnung von der drohenden Apokalypse. Ok, ganz neu ist das nicht. Irgendwie wirkt vieles bekannt, vor allem wohl aus George Romeros Dawn of the Dead (1978). Aber gut geklaut ist für mich trotzdem die halbe Miete. Tarantino ist schließlich nicht der Einzige der damit Kohle scheffelt. Die Handlung ist schnell erzählt: Ein Virus hat wohl von einer handvoll Menschen Besitz ergriffen, die zu Beginn des Films in einem anonymen Flugzeug in einer nicht näher benannten amerikanischen Stadt landen. Es gelingt diesen „Zombies“ (später stellt sich heraus, dass es doch „lediglich“ radioaktiv verseuchte Menschen sind) in die Stadt einzudringen, wobei sie eine blutige Spur der Gewalt hinterlassen. Sie scheinen sinnlos alles zu attackieren was sich bewegt, wobei im Verlauf des Films auch klar wird, dass sie für ihr Überleben ständig frisches Blut benötigen. Also eher eine Mischung aus Vampir und Zombie, denn laufen, prügeln, autofahren und mit Maschinengewehren um sich schießen können sie auch. Der Protagonist, der die Invasion auf dem Flughafen miterlebt hat, ist Reporter, darf aber nicht berichten. Das Militär übernimmt, jedoch soll bei den Bewohnern der Stadt keine Panik ausgelöst werden. Natürlich kommt es wie es kommen muß. Die Situation gerät mehr und mehr außer Kontrolle, da die Infizierten praktisch unverwundbar sind und sich beliebig vermehren können.
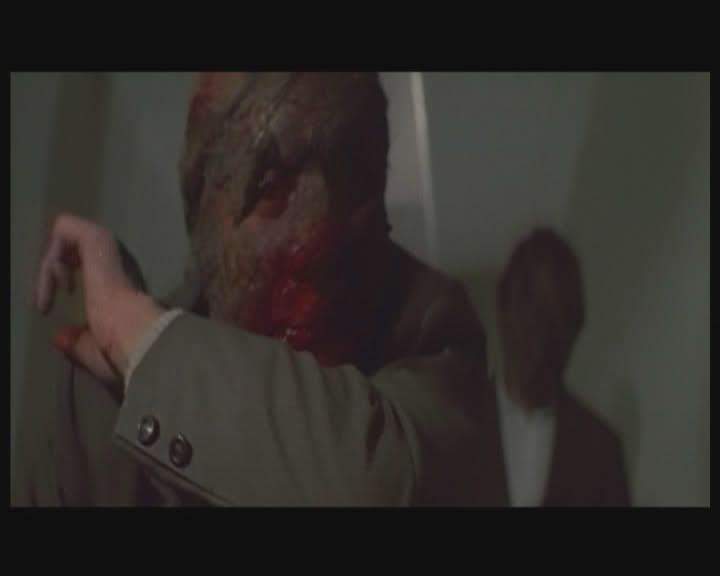
Natürlich ist das Ganze nicht vollkommen ernstzunehmen. Die Dialoge sind meist hahnebüchen, das Make-up und die Splatterszenen grotesk, von stringentem Handlungsaufbau oder gar erzählerischer Kohärenz ist nichts zu spüren. Trash vom Feinsten könnte man also meinen. So einfach ist es jedoch nicht. Umberto Lenzi ist kein Amateur, versteht zumindest in einigen Aspekten sein Handwerk ausgezeichnet, und in seinen Filmen findet sich neben aller Übertreibung auch einiges an Ambivalenz was gesellschaftliche Zustände anbelangt. So auch in „Großangriff der Zombies“. Nicht zuletzt wegen der großartigen Schlußwendung (die ich an dieser Stelle nicht verraten will) rückt der Film in die Nähe von traumähnlichem (italienischen) Genrekino à la Argento, Fulci oder Bava. Dass es Lenzi nicht um einen traditionellen Realismusbegriff geht ist schon relativ bald klar. Realitätsfern ist der Film jedoch bei weitem nicht. Das Szenario einer Invasion von Außen war während des kalten Krieges ein beliebter Topos, doch Fulci gibt dem teilweise durchaus reaktionären Gestus seines Films einen interessanten Twist, wenn er das Bodysnatcher-Motiv leicht umfunktioniert. Denn wie es an einer Stelle des Films explizit formuliert wird: Die infizierten Lebewesen sind eindeutig keine Aliens, sondern Menschen wie du und ich. Und infiziert wird jeder der mit ihnen in Berührung kommt. Der Film trägt seine Botschaft denn auch über weite Strecken der Handlung vor sich her, und Fulci lässt seinen Protagonisten und dessen Freundin, die wir den ganzen Film über auf der Flucht beobachten, in einigen Szenen tatsächlich innehalten, nur um dem Zuschauer die (vorgeschobene) Argumentation wiederholt vorzuhalten: Die Menschen an sich sind schlecht (sprich infiziert), weil sie machtgierig sind, weil sie Fortschritt mit Technologie verwechseln, und weil sie sich schon längst von ihrer wahren Natur entfremdet haben. Der Zombie als natürliche Folge der (eingeschlagenen) Evolution. Neu ist das nicht, aber es funktioniert.

In Verbindung mit zahlreichen surreal anmutenden Sequenzen, die in den gelungensten Momenten an Fulcis „The Beyond“ (der tatsächlich später entstanden ist), besagten Romero und eben auch an die Traumwelten aus Argentos Suspiria und vor allem Inferno erinnern (besonders eindrucksvoll: Der Endkampf im verlassenen Vergnügungspark auf den Achterbahnschienen!), entsteht eine doch sehr eigenwillige Horrorfabel. Wer einen traditionell ernsthaften Genrefilm erwartet, wird aber wohl eher enttäuscht. Wie gesagt, kann man das natürlich auch alles lächerlich finden, und sich an den vorgeblichen Peinlichkeiten der Inszenierung ergötzen. Persönlich finde ich die Inszenierung in letzter Konsequenz (vor allem angesichts des Endes) jedoch durchaus agemessen und im Sinne einer spezifischen Reflektion über den Zustand der Welt auch kohärent. Was mir anfangs oft übel aufstieß oder einfach nur auf die Nerven ging, macht am Ende Sinn. Für mich war „Großangriff der Zombies“ eine lohnende und eindrucksvolle Erfahrung. Vielleicht lese ich in den Film zuviel hinein, und stehe in Wirklichkeit einfach nur auf die Kombination von Authentizität vermittelnder Handkamera und phantastischem Sujet, weil sich in diesem scheinbaren Widerspruch für mich automatisch zahlreiche Reflexionsebenen ergeben die die körperliche Erfahrung zwangsweise mit der psychischen verbinden, auch weit über den Film hinaus (siehe hierbei die beiden meiner Meinung nach großartigen Kannibalenfilme von Ruggero Deodato, Cannibal Holocaust und Ultimo mondo cannibale). Man könnte das als transgressiv bezeichnen – oder einfach von „Der Zauberer von Oz meets Jack the Ripper“ sprechen (mit einer Prise Ed Wood). Gegensätzliches, und scheinbar Unvereinbares ergibt oft die interessantesten Kombinationen.

Der innere Widerspruch der sich in „Großangriff der Zombies“ aus ausgestelltem voyeuristischem Exzess und einer offensichtlichen, im Grunde vielleicht banalen Gesellschaftskritik ergibt, erzeugt einen Widerstand der reinen Oberfläche, eine Öffnung zugunsten eines möglichen Phantasmas. Das heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass der Film für mich in der Auseinandersetzung unheimlich gewinnt. „Großangriff der Zombies“ ist ein Musterbeispiel für die in der bürgerlichen Kritik oft verleugneten Qualitäten des Genrekinos, nicht nur im Italien der 60er, 70er oder 80er Jahre (genausogut könnte man manchen „Unterhaltungsfilm“ der NS-Zeit, oder das frühe Stummfilmkino – vor der Herausbildung der künstlerischen Ambitionen der 20er Jahre – als Beispiel heranziehen). Man könnte noch einiges über Lenzis permanente Fetischisierung des Körpers schreiben, die ent/subjektivierung des Blicks, oder die Ökonomie von Objekten. Ob es für einen guten Film auch einen guten Regisseur braucht weiß ich nicht. Aber dass ich noch viel mehr von Umberto Lenzi sehen will steht für mich nun eindeutig fest.


Wenn ich von Bergman geredet habe, habe ich bisher eigentlich meistens von Nykvist geredet. Zumindest im Positiven. Die meiner Meinung nach negativen Aspekte in Bergmans Filmen (und für mich gab es derer meist viele, da ich nie ein Anhänger von ihm war), ließ ich gerne auf ihn zurückfallen. Deshalb geriet ich während der Sichtung von Sommaren med Monika (DT: Die Zeit mit Monika / Schweden / 1953) auch schnell wieder ins Schwärmen über „Nykvists naturalistische Kameraarbeit“. Umso verwunderter war ich, als ich nach dem Film herausfand, dass Nykvist bei diesem Film seine Finger nicht im Spiel gehabt hatte. Nun ja, völlig sicher war ich mir während des Films auch nicht gewesen (Nykvists Name war mir bei den Titeln des Vorspanns nicht ins Auge gesprungen), aber auf irgendjemanden musste ich meine Begeisterung doch projizieren – und Bergman selbst konnte diese Rolle für mich natürlich nicht ausfüllen.

Viel wurde in den letzten Jahrzehnten über die legendäre Zusammenarbeit von Bergman und Nykvist geschrieben. Doch dass Bergman auch einen anderen wichtigen Kameramann besaß, mit dem er mindestens 12 Spielfilme gedreht hat, ist weniger bekannt. Gunnar Fischer war auch für die wundervolle Kameraarbeit in „Die Zeit mit Monika“ verantwortlich, und die Bildsprache erinnert bereits vollkommen an die späteren Kollaborationen mit Nykvist. Viel von Sjöström ist hier zu sehen, vor allem bei der Arbeit mit Überblendungen und Natursymboliken (aber auch in der Montage), und Elemente des amerikanischen Film Noir werden ebenso aufgegriffen wie Charakteristika des Weimarer Kinos (in den Straßenszenen werden Erinnerungen an Pabst wach, und die Innenhöfe von Wohnblöcken könnten direkt aus Fritz Langs „M“ entnommen sein). Der Einfluß des italienischen Neorealismus der dem Film wohl aufgrund seiner zahlreichen Außenaufnahmen nachgesagt worden ist (und der im Prinzip in der gesamten europäischen Filmgeschichte nach Beendigung des 2. Weltkrieges als Ausgangspunkt unzähliger Beobachtungen dienen mußte), erschließt sich mir jedoch nicht vollständig. Vielmehr würde ich eine Analogie zum japanischen Kino der Nachkriegszeit ziehen, vor allem des psychologischen Realismus, welches mit Akira Kurosawas Rashômon (Japan / 1950) nach dem Erfolg bei den Filmfestspielen von Venedig 1951 in Europa große Anerkennung erlangte. Die kontrastreiche schwarz-weiß Photographie der Naturaufnahmen besitzt einige Eigenheiten dieser in Europa populären japanischen Filmästhetik der 50er Jahre, so z.B. in der spezifischen Integrierung von Landschaft in die Mise-en-scène, und den ausdrucksstarken Umgang mit Licht (das Rauschen der Blätter in Rashômon und die Spiegelung der Sonne auf ihrer Oberfläche schießen mir ins Bewusstsein).

Diese Sinnlichkeit ist es auch, die für mich als Erweiterung der Eingangssequenzen in der Stadt – dem Prolog wenn man so sagen will – und einer Ästhetik, die Truffaut in seinen frühen Kurzfilmen und vor allem in Les quatre cents coups (Sie küßten und sie schlugen ihn / Frankreich / 1959) wieder aufgreifen sollte (und die (dadurch?) interessanterweise für viele „Neue Wellen“ des europäischen Kinos der 60er Jahre wegweisend werden sollte), das Zentrum der Erzählung (vor einem weiteren Wendepunkt und dem dadurch eingeleiteten Epilog) dominiert. Die Visualisierung der Flucht der Protagonisten in „ihren“ Sommer ist dann auch dasjenige, was den Film für mich besonders macht. Die Natur führt in diesem Abschnitt ein Eigenleben. Beobachtet wird sie hierbei durch die personalisierte Kamera, die in diesen Sequenzen das interessanteste, da agilste Subjekt darstellt. Sie sieht alles, spürt alles, Figuren, Landschaft, Schauplätze, Gefühle – das Seelenleben der Objekte, ob Mensch oder Natur. Und doch entzieht sie sich selbst (als Apparatur) jeder Darstellbarkeit. In der Abwesenheit des Konstruktes Kamera für den Zuschauer, wird sie zum materialisierten Außen, dem unsichtbaren aber konkreten Raum. Als solches verdrängt das Kamera-Auge durch seine Präsenz alles was sich „vor“ ihr befindet, indem es sich das Davor, die Welt davor, einverleibt. Paradoxerweise erscheint aber in dieser aufgenommenen Welt das Innere der Orte und Objekte umso nachdrücklicher. Sie werden, wie die Personen selbst, zur Seelenlandschaft, eingefangen in der Kamera. Die Oberflächen sind besetzt, besessen vom Leben, von der Intensität des Lichtes und der Struktur der Schatten die sich auf sie eingeschrieben haben.

Somit führt der aufgenommene Film den Zuschauer nicht in die Welt „da draußen“, ist nicht Abbildrealismus, sondern öffnet sich vielmehr nach Innen, ins Reich der Phantasie, der Sehnsüchte und Wünsche, der Ängste. Erst durch die Projektion im Kinosaal wird wieder eine Fläche nach Außen geöffnet, wobei der Zuschauer hierbei wiederum den ursprünglichen Akt der Kamera nachvollziehen kann: Er konsumiert die Ereignisse, überführt sie in seine Sprache. Filme machen und Filme sehen als Aneignung der Welt.


Je mehr ich von Carpenters Filmen ab 1990 sehe, desto mehr drängt sich mir der Verdacht auf, dass die immer mal wieder aufgeschnappte Behauptung Carpenter habe nach THEY LIVE konstant abgebaut, nicht mehr als ein böswilliges Gerücht ist. GHOSTS OF MARS zum Beispiel, wurde bei seinem Kinostart übelst verrissen, zwei Jahre nach MATRIX hatte offenbar niemand mehr Lust auf handgemachte Genrekost, selbst eingefleischte Carpenter-Fans loben höchstens noch den Trash-Faktor des Films. Aber mal im Ernst: Allein die Idee, ASSAULT – ANSCHLAG BEI NACHT ein futuristisches Update auf dem Mars zu geben, mit Courtney Love in der Rolle von Ethan Bishop und Ice Cube als Napoleon Wilson, hat einen sehr verrückten Charme.
Und wenn Courtney Love nicht eine Woche vor Drehbeginn die Ex-Frau ihres Lovers über den Fuß gefahren wäre, Carpenters Casting-Coup wäre voll aufgegangen. Mit Love als Vertreterin des (feministischen) Hardcorepunks und Grunge und mit Ex-N.W.A.-Mitglied Ice Cube als Vertreter des Westküsten-Hip Hops, bzw. Gangsta Raps wären die Verteter zwei der wichtigsten amerikanischen Subkulturen der Neunziger (die 2001 natürlich schon längst Geschichte und in Mainstream und Ausverkauf angekommen waren) aufeinander getroffen. Wenn man sich jetzt noch daran erinnert, dass die Gangproblematik und Ghettobildung in L.A. eine Art mythologischen Hintergrund für ASSAULT bildete, ist die Besetzung von dem aus South Central stammenden Ice Cube, der mit Liedern wie „Black Korea“ den Soundtrack zu den Rodney King riots von 1992 lieferte, doppelt interessant.
Leider kann Natasha Henstridge Love nicht wirklich ersetzen, aber das wäre auch schon der einzige Kritikpunkt den ich vorbringen kann. Ansonsten hat der Film einen wunderbar trashigen, hemdsärmeligen Charme und wirkt mit seinen Pappkulissen in Zeiten als CGI und Blue Screens gerade groß im Kommen waren natürlich völlig aus der Zeit gefallen, aber eben auch wie eine nostalgische Hommage an die anpackende, schnörkellose Kunst B-Filme zu drehen. Toll auch die sexuell aufgeladene Atmosphäre in der sich die Figuren ständig Anzüglichkeiten an den Kopf werfen und sich gegenseitig flachlegen wollen, aber nie richtig zum Zug kommen (Jason Stathams Begehren erinnert da doch sehr an die Zigarette, die Napoleon Wilson in ASSAULT so vehement verlangt und erst von Laurie Zimmer gegen Ende des Films überreicht bekommt). Und wie immer bei Carpenter ist natürlich der Western nicht weit: Die verlassende Stadt in der Wüste, der Saloon, der großartig inszenierte Zugüberfall am Schluß. Ein wirklich starker Film.
„The Thing“ – so schlicht und bescheiden sich dieser Filmtitel auch anhört, so problematisch und hintergründig wird er, wenn man ihn auf dem Hintergrund der Philosophiegeschichte betrachtet. Was ist das eigentlich, ein Ding, ein Etwas überhaupt, unausgemacht ob Mensch, Tier, Pflanze oder Gestein, Gegenstand oder Eigenschaft, Realität oder Einbildung? Kann man dieses „Etwas=x“ definieren, allgemeine Aussagen darüber treffen, die dann auf jedes Etwas und seine Verhältnisse zu anderem etwaigen in jedem Falle zuträfen? Dies war der Versuch der klassischen Metaphysik, spätestens seit Aristoteles, der sein Etwas, seine Ousie, jedoch nicht definiert haben, sondern in einer paradigmatischen Wirklichkeit ideal verkörpert sehen wollte, von der aus die anderen, abgeleiten Wirklichkeiten dann analog bestimmbar wären. Doch nicht nur die Philosophie, auch die Theologie laborierte immer am Ding, genauer gesagt an seiner Einheit, Zweiheit oder Dreiheit. Inwiefern ist Gott ein Ding – eine Ousie=Ding – und doch auch drei (Hypostasen = Dinge), inwiefern der Christus ein doch immer auch und ebenso auch wieder nicht zwei Dinge?
Was soll es also genau sein, dieses Etwas oder Ding? Schließlich ist auch ein Unding ein Ding, eben ein Etwas, genau wie jede Art von Phantasiegebilde oder auch jede Art von Nichts: Das Nichtvorhandensein von Geld etwa, Schulden oder Zahlungsunfähigkeit, können ein eminent wirksames und verheerendes Ding sein, ebenso wie das Nichtvorhandensein von Zeit, Kraft, Witz oder auch Verstand. So kam man in der idealistischen Tradition, spätestens aber mit Kant, auf den genialen Kunstgriff, daß Aussagen über das Etwas als Etwas, das ens qua ens, als solche unmöglich sind, da dieser Begriff sich letztlich in seiner Überabstraktion selbst aufhebt: Möglich sind Aussagen über das Etwas oder Ding als solches nur insofern es Objekt ist, also Erkenntnisgegenstand einer Subjektivität: Das gesuchte Ding oder etwas ist also immer das Objekt, der Gegenstand überhaupt auf den wir uns erkennend und wollend beziehen.
Weit entfernt von philosophischer Naivität scheint die filmische Bearbeitung des Themas diese Erkenntnis immer vorauszusetzen, so daß man Aristoteles fast ein wenig bemitleiden muß, daß er nicht einfach ins Kino um die Ecke gehen und sich seine Ousie, sein Etwas, sein Ding von Christian Nyby und John Carpenter hat erklären lassen. Ersterer setzt nämlich schon im Titel („The thing from another world“) die fundamentale Differenz zwischen diesseitigem Subjekt und andersweltlichem Ding, also jenseitigem Objekt der Erkenntnis voraus, während letzterer, in Wahrung des Hegelschen Satzes vom Bewußtsein, diese Differenz (trotz der Ignoranz deutscher Verleiher) bereits wieder eingezogen hat und voraussetzt, daß jede erkennende Subjektivität das Ding nur von sich unterscheidet, indem sie es gleichzeitig auf sich bezieht. Hier tut sich also bei allem grundsätzlichen Konsens in der Herangehensweise bereits eine metaphysische Spannung zwischen beiden Regisseuren und Epochen (1951 und 1982) auf, die in der lebensweltlichen Vermittlung, der konkreten filmischen Umsetzung des metaphysischen Themas geradezu zu diametral auf den Kopf gestellten Verhältnissen führt, zu einer totalen Umpolung im wahrsten Sinne des Wortes: Siedeln die fünfziger Jahre die Geschichte nämlich oben, auf dem von den Amerikanern kontrollierten (aber auch an Rußland grenzenden) Nordpol an, wählt der Carpenter der frühen Achziger das unten, die Einsamkeit und Abgeschiedenheit des Südpols. Bedenkt man die unterschiedlichen metaphysischen Vorzeichen ist dies sicher alles andere als bloßer Zufall: Wie gesehen setzte Nyby in der titularen Gestaltung des von ihm vorgestellten Ding- oder Objektbezuges mit der radikalen Differenz ein. Das Objekt oder Ding ist das ganz andere, dem Geist äußerliche, welches ihn aber, umso widerständiger und äußerlicher es ihm erscheint, desto mehr anspornt, es zu überwinden und es sich symbolisierend und organisierend, erkennend und handelnd anzueignen. In den Fünfzigern bildet die Menschheit eine Einheit in ihrem Erkenntnis- und Organisationsstreben, eine Einheit, die auch durch das ihr von oben entgegenkommende, photosynthesefähige und gefühllose „Rübenwesen“ (die humoristischen Einlagen des Journalisten entsprechen ganz dem heiter-zielbewußten Optimismus des aneignungssicheren Dingbezugs) aus dem Weltall nicht ernsthaft in Frage gestellt wird, sondern sich nur innerlich bewähren muß: Ist die Spannung zwischen Erkennen und Organisieren, Wissenschaft und Militär erst ausgefochten, dann hat eben in diesem Fall der erkenntnishungrige Professor das Nachsehen, doch ist ganz klar, daß das Ding überwunden und angeeignet wird. Letztlich kann die ganze Geschichte den Gang der menschlichen Angelegenheiten nicht in Frage stellen, sondern wird zum bloßen Katalysator, der der Menschheit einen neuen Sieg und unseren Helden Cpt. Hendry und der kessen Sekretärin Nikki die erwünsche Hochzeit bringt.
Ganz anders jedoch der Objektbezug bei Carpenter: Hier erscheint der Mensch verzweifelt an der Aneignung des Außen und ganz Zurückgeworfen in das Innen, nicht oben, auf dem Nordpol, dem Himmel entgegen, sondern unten, abgeschieden in der Antarktis, konfrontiert mit etwas, was seit tausenden von Jahren im Erdboden schlummert, genauer gesagt wohl in den Tiefen des eigenen Selbst. Nicht die amerikanische Gruppe als Speerspitze der Menschheit selbst stößt hier auf das Ding, sie muß vielmehr im Nachhinein mit etwas fertig werden, was Generationen vor ihr längst entfesselt haben und an dessen Aneignung sie verzweifelt und zugrunde gegangen sind. Das Ding ist daher auch kein dem Menschen überlegenes Wesen eigenen Rechts, vielmehr nichts weiter als ein hinterhältiger, die menschlichen Zellen von innen befallender und schließlich klonender Retrovirus, der sich überall um uns herum und in einem jeden von uns verbergen könnte.
Will die Menschheit hier weiter kommen, so jedenfalls nicht in der erkennenden oder handelnden Aneignung des Außen, sondern höchstens in der Transformation des Innen. Verzweifelt am Oben und Außen, wendet sich die Subjektivität in ihrem Ding bezug also nach unten, zum Innen, doch allerdings nur um festzustellen, daß dieses, verobjektiviert und zum Gegenstand geworden, ebenfalls Ding und damit dem subjektiven Selbst äußerlich werden muß: Niemand weiß genau, ob er selbst, sein Freund, Zimmer- oder Bettgenosse den Virus bereits im Blut haben, ob wir uns also selbst sehen oder nur unseren Übergang zum Ding, einem Etwas, von nicht nur nichts wissen, sondern das wir vor allem auch keinesfalls kontrollieren können, nicht einmal mit allem Sprengstoff, der sich in der antarktischen Militärbasis finden läßt. Aus dieser überpessimistischen metaphysischen Perspektive bleibt dem Regisseur wie dem Zuschauer abschließend nur die bange Frage: Wo warst Du? Wo war ich? Was bleibt, als abzuwarten, ob wir Ich bleiben oder Ding werden?
Wiederholt wurde Platons zu Beginn des siebten Buches seiner Politeia beschriebene Höhle als erstes Kino der Geistesgeschichte bezeichnet, und das aus naheliegenden Gründen: Unsere Alltagsrealität wird dort mit einer finsteren Höhle verglichen, in der die Menschen gefesselt unter einer Mauer sitzen und auf eine große (Lein-)Wand starren, auf die, kraft einer in ihrem Rücken befindlichen Funzel, der einzigen Lichtquelle der Höhle, die Schattenrisse von allerart Zeugs projiziert werden, das hinter der Mauer in ihrem Rücken entlanggehende Unbekannte dort vorbeitragen. Morphologisch deckt sich dies sicher relativ weitgehend mit den Lebensverhältnissen gerade obsessiver Cineasten, welche tatsächlich an die Leinwand gefesselt sind, da sie das Kino – eingestandener- oder uneingestandenermaßen – für die bessere, eigentlichere Form der Realität halten. Man könnte im Cineasten also mit Platon in der Tat eine besonders degenerierte Form seines Höhlenmenschen sehen, zumal er nicht nur mit der Masse die eigentliche Realität für die wahrnehmbare Alltagswelt eintauscht, sondern selbst dieser noch deren auf Zelluloid gebannte und damit noch einseitigere und seinsärmere Abbilder vorzieht. Der Cineast wäre somit das abschreckendste Beispiel von Degeneration einer auf die (scheinbar) wirksame und wahrnehmbare Oberfläche der Dinge fixierten Menschheit, die jede Fähigkeit, diese auf deren transzendenten Grund hin zu übersteigen, abgelegt, und sich gänzlich im Spiegelkabinett materieller Defizienz verfangen hat.
Andererseits muß nicht jeder Cineast das Kino mit der wahren Wirklichkeit verwechseln. Im Gegenteil kann ein reflektierter Umgang mit Kino und Medialität überhaupt sogar genau dazu beitragen, wozu Platon durch das Höhlengleichnis aufrufen will: Seine Fesseln zu lösen, zum Ausgang aufzusteigen, draußen die wahre Wirklichkeit zu schauen und nach deren Schau schließlich wieder zurückzukehren, um anderen zu selbigem Aufstieg zu verhelfen. Platon selbst rekurriert ja ausdrücklich auf die wahrnehmbare Abbildstruktur, um das von ihm anvisierte Verhältnis von uneigentlicher, wahrnehmbarer und wahrer, intelligibler Wirklichkeit zu verdeutlichen: Wie wir einen wahrnehmbaren Gegenstand in einem Spiegelbild oder auf einer Abbildung als solchen immer nur defizient erkennen können, da die Abbildung eben nur eine Perspektive, einen durch ein Medium wie Malerei oder Bildhauerei vermittelten Ausschnitt oder Aspekt dieses Gegenstandes vermitteln kann, so vermittelt die wahrnehmbare, ausgedehnte, an eine konkrete Raum-Zeitstelle gebundene Instanz einer Wesenheit immer nur einen durch die konkreten Gegebenheiten eingeschränkten und durch den Blickwinkel der Wahrnehmung getrübten Aspekt dieser Wesenheit selbst: Was es wirklich, überall und zu allen Zeiten hieß, Mensch zu sein, werden wir niemals erkennen, wenn wir nur diesen konkreten oder auch beliebig viele andere menschliche Körper anstarren: Dies gelingt vielmehr nur durch die geistige Besinnung auf die elementarsten und wahrsten Ausdrücke des Menschseins und die sich ihnen äußernde eine, ewig sich gleichbleibende Essenz. Natürlich wird diese ständig verdeckt durch ihre durch die Alltagserfahrung immer neu induzierte Verwechslung mit einer ihrer konkreten Ausprägungen, also genau derjenigen medialen Täuschung, die Platon im Höhlengleichnis ankreidet. In einem selten beachteten Paralleltext, dem Schlußmythos des Phaidon, macht er dies noch etwas klarer: Dort entwirft er eine Vorstellung der Erde als von unterschiedlich tiefen und teilweise mit Wasser oder Nebel gefüllten Höhlen durchlöchertem „Fußball“, dessen unterschiedliche Regionen sehr unterschiedliche Arten von Bewohner hervorbringen, je nach dem Medium, durch das diese nach oben, auf die Wirklichkeit der wahren Oberfläche blicken: entweder aus dem nur durch gebrochenes Licht erleuchteten Wasser, dem allzumal von einem filigranen Glanz durchlichteten Nebel oder der in den Höhlen angestauten „dicken Luft“. Wie viele verschiedene Begriffe von Wirklichkeit diese unterschiedlichen Medien hervorbringen müssen, kann man sich vorstellen: Jede Region imponiert die im eigenen Medium gewohnte Wahrnehmung auf die Bewohner und läßt sie diese für die ultimative Form der Wirklichkeit halten, wobei diese jedoch nur an der echten Oberfläche, im reinen Medium des Äthers wirklich gesehen werden kann.
Wie würde es nun in diesen unterschiedlichen Regionen mit der Kunst stehen? Ist Kunst für Platon im Prinzip nichts anderes als Abbild des Abbilds, so würden die Künstler der verschiedenen Regionen die jeweils unterschiedlich gebrochenen Abbilder ihrer Wirklichkeit in einer analog gebrochenen Weise wiederum abbilden: Es käme zu nebelhaften Schemen umwölkter Silhouetten oder zu trüben Spiegelungen wässriger Brechungen. In jedem Fall würde die Kunst für das philosophisch erwachte Auge in der Art ihrer Abbildung immer die Signatur des jeweiligen Mediums tragen und auf diese Weise dazu beitragen können, die Art der medialen Täuschung, Stilisierung oder Vereinseitigung zu durchschauen. Kunst könnte dann nicht nur als Abbild des Abbild, sondern als Abbilden des Abbildens wahrgenommen werden und so als Anfang, wenn nicht sogar als Medium der Philosophie dienen.
Wäre dies jedoch der Fall, so böte gerade die besagte analoge Struktur von Kino und Höhle eine hervorragende Chance, mediale Repräsentation in ihrer Reinstform zu studieren, also die Wahrnehmung von etwas als etwas durch etwas drittes, ein Medium, das dabei selbst aber unthematisch bleibt. Und genau in diesem unthematischen Charakter des Mediums liegt die Gefahr in Platons Höhle: Die Gefangenen sehen die Dinge als Schemen, vermittelt durch die in ihrem Rücken befindliche, ihnen selbst unbewußte, Funzel am Höhlenausgang. Der Philosoph hingegen sieht direkt in die Sonne, blickt in die Idee des Guten und wird sich so über das Medium klar, dem alle Dinge ihr Sein und ihre Existenz verdanken. Auf einer niedrigeren Stufe kann die Reflexion auf das Medium Film ähnliches leisten, um mit unserem alltäglichen Generalmedium, der Erfahrung bzw. der Höhlenfunzel, reflektierter umzugehen.
Es gilt also, darauf zu achten, wie uns ein Film den Menschen, die Welt als Mensch oder Welt (wie er sie sieht) wiederum in einem bestimmten Medium zeigt, dialogisch, situativ oder visuell. Szenen oder Geschichten, Gespräche und Bilder bilden alle für sich genommen, aber auch in der jeweils konkreten Summe nur einen bestimmten erfahrungsabhängigen Ausschnitt dar, in dem wir Welt oder Mensch als das sehen, als was wir sie (in unserer eigenen Erfahrung) sehen wollen bzw. (in dem vom Film gezeigten Ausschnitt) sehen sollen. So zeigt uns ein Fassbinder den Menschen als in sich selbst gefangenes, an jeglicher Beziehung zum scheitern verdammtes Individuum im Medium konkreter Szenen und Dialoge aus dem tristen Alltagsleben, das klassische Hollywoodkino, etwa eines Frank Capra, hingegen als eingebettet in eine letzten Endes gelingende, von metaphysischer Sinnganzheit getragene Weltgemeinschaft in großen, paradigmatischen und von der Alltagsrealität abgelösten Geschichten. Die von Platon ausgehende Herausforderung an den Cinéasten besteht nun darin, keine der beiden Aspekte mit der Realität zu verwechseln und damit selbst in der jeweiligen Höhle angekettet zu bleiben, sondern sich zu einer Perspektive aufzuschwingen, die beides in einer umfassenden Idee von Welt und Menschheit, die ihrerseits nur im transzendenten Grund erschwinglich ist, zu vermitteln.
Bin gerade etwas auf dem Tatort-Trip und versuche mehr über die wunderbar sleazig klingende Folge Der gelbe Unterrock aus dem Jahr 1980 herauszufinden, die nach ihrer Erstausstrahlung im Giftschrank des SWR verschwunden ist. Generell faszinieren mich die Tatort-Folgen aus den Achtzigern, schon allein wegen den so merkwürdig fremd und fern wirkenden Bildern aus der „alten“ BRD. Zum Beispiel im Schimanski-Tatort Das Mädchen auf der Treppe, wenn die Kamera über den Tatort schwenkt und sich hinter den klobigen Einsatzwägen und den grauen Mietshäusern vor einer brachen Wiese die riesige Zeche aufbaut. Oder das blinkende, alte Bierschild im Hintergrund der Kneipenszene. Überhaupt wirkt das alles gar nicht so wie die meisten Fernsehfilme, die man heute so sieht, sondern viel filmischer, näher am Kino. Und das nicht nur, weil der Soundtrack wie bei Michael Mann oder Kathryn Bigelow von Tangerine Dream stammt:
(Über das Benutzerprofil des Users bei Youtube findet man noch eine Zusammenstellung des Tatorts Miriam von 1983, bei dem die Musik ebenfalls von Tangerine Dream stammt.)
Übrigens zeigt 3sat nächsten Sonntag (also den 23. August) die Folge Reifezeugnis von Wolfgang Petersen mit Nastassja Kinski aus dem Jahr 1977. Und Dominik Grafs Jubiläumstatort Frau Bu lacht wird am 24. August im SWR und am 10. September im WDR wiederholt.
Eine kurze Link- und Neuigkeitensammlung zum aktuellen Festivalgeschehen, das jetzt von Spätsommer bis Herbst mit den drei „Großen“ Locarno, Venedig und Toronto hoffentlich für viel Diskussionsstoff sorgen wird:


Gestern abend ist das 62. Filmfestival in Locarno zu Ende gegangen, Sieger des Goldenen Leoparden ist der chinesische Film She, A Chinese von Xiaolu Guo. Zweiter großer Gewinner ist der russische Film Buben, Baraban von Alexei Mizgirev, der sowohl den Spezialpreis der Jury, als auch den Preis für die beste Regie gewann. Alle Preisträger gibt es auf der offiziellen Festivalhomepage.
Ausführliche Berichterstattung über das Festival gab es von Lukas Foerster bei CARGO und im (auch sonst sehr lesenswerten) Blog von Michael Sennhauser vom Schweizer Radio DRS.
Noch interessanter als der aktuelle Wettbewerb dürfte die Reihe Manga Impact zum japanischen Animationsfilm gewesen sein, die einen kompletten Abriss seiner Geschichte von den Anfängen bis heute darstellte. In ihrer Ausführlichkeit ist diese Retrospektive bisher in Europa wohl kaum übertroffen, leider lassen sich darüber bisher abgesehen von den beiden schon erwähnten Festivalberichten kaum nennenswerte Artikel im Netz finden. Lediglich von Rüdiger Suchsland gab es in der Printausgabe (aber nicht online) der FAZ vom 13. August einen Bericht, in dem er vor allem von First Squad: The Moment of Truth von Yoshiharu Ashino schwärmte, in dem japanischer Anime und russisches Revolutionskino aufeinandertreffen. Auch Michael Sennhauser war sehr angetan von dem Film, der in Locarno internationale Premiere hatte. Den Trailer dazu gibt es hier.
 Weiterlesen “Aktuelle Festivalrundschau” »
Weiterlesen “Aktuelle Festivalrundschau” »
Er ist schon fast legendär, der Kleinkrieg zwischen Vincent Gallo und Roger Ebert um die völlig missglückte Projektion von The Brown Bunny in Cannes 2003, als Ebert den Film außer sich vor Wut den schlechtesten Film in der Geschichte des Festivals schimpfte. Zwar ist der Streit zwischen den beiden, der zwischenzeitlich in üblen Verfluchungen mündete, längst beigelegt (nicht zuletzt weil Ebert Gallos ein Jahr später in Toronto gezeigte, neue Schnittfassung durchaus gefiel) – den Titel „schlechtester Film in der Geschichte des Fesitvals“ trug The Brown Bunny zumindest in seiner ursprünglichen Version aber weiterhin. Bis dieses Jahr im Wettbewerb von Cannes ein Film des philippinischen Regisseurs Brillante Mendoza lief, der Ebert dermaßen in Rage versetzte, dass er sich bei Vincent Gallo entschuldigte und den Titel für den miesesten Cannes-Beitrag aller Zeiten an Kinatay weiterreichte. Zwar waren die Zuschauerreaktionen insgesamt nicht ganz so extrem und hasserfüllt wie seinerzeit bei Brown Bunny, doch auch aus Mendozas Film sollen die Leute, so wird zumindest berichtet, in Scharen geflohen sein und nach Ende der Vorstellung ihrem Unmut lautstark Luft gemacht haben.

Dieser Schock wirkte beim französischen Produzenten Didier Costet, der bei der Deutschlandpremiere von Kinatay auf dem diesjährigen Münchner Filmfest anwesend war, sichtlich nach und so bat er das Publikum bereits im Voraus sich doch bitte auf die sicher schockierende Erfahrung einzulassen und nicht gleich aus dem Saal zu rennen. Diese Warnung wäre allerdings nicht nötig gewesen, denn obwohl einige wenige Zuschauer das Kino vorzeitig verließen (wenn auch nicht mehr als in anderen Vorstellungen), verlief die Projektion ganz ohne Buhrufe und Radau, stattdessen gab es nach dem Film sogar eine recht angeregte Diskussion mit Costet. Interessant wie sich die Wahrnehmungen des Festivalpublikums in Cannes und München zu unterscheiden scheinen, ob das nun an unterschiedlichem Grad an Leidenschaft liegt oder daran, dass in der Münchner Spätvorstellung verhältnismäßig wenige Sektschlürfer bei verhältnismäßig vielen Cineasten (u.a. Fabrice du Welz) anwesend waren, sei mal dahingestellt.
Angeheizt wurde die Kontroverse in Cannes zusätzlich von der Jury um Isabelle Huppert, die Brillante Mendoza den Preis für die beste Regie verlieh. Kinatay setzte damit den Erfolg fort, den das philippinische Kino mit Regisseuren wie Lav Diaz oder Raya Martin seit langem auf westlichen Filmfestivals feiert. Tatsächlich ist der Regiepreis nicht unverdient und die Empörung um den Film nur schwer nachvollziehbar. Die Hauptfigur von Kinatay, Peping, ist ein junger Familienvater und Polizeischüler in Manila, der in der Ausbildung nicht genug verdient, um seine Frau und seine kleine Tochter ernähren zu können und deshalb nachts einem Zuhälter beim Geld eintreiben behilflich ist. Der Film deckt einen Zeitraum von nur 24 Stunden ab und zeigt zunächst Alltagsszenen aus den Straßen von Manila, dann die Hochzeit von Peping, die wegen des Geldmangels sehr unspektakulär verläuft, aber doch den Eindruck einer harmonischen Kleinfamilie vermittelt. Erst im Wechsel vom Tag zur Nacht liegt ein unvermittelter Bruch: die Nachtszenen sind in HD gedreht, grobkörniger, dunkler, hektischer, nervöser als das 35mm-Material, das am Tag zum Einsatz kommt. Dem formalen Bruch folgt ein inhaltlicher, ein Bruch im Leben zweier Menschen, denn in dieser Nacht geschieht etwas für Peping Unerwartetes: eine Prostituierte, die seinem Boss Geld schuldet, wird in ein Auto gezerrt, niedergeschlagen, gefesselt und entführt. Tatsächlich beginnt jetzt eine Tour de Force für Peping und für den Zuschauer, dessen Perspektive eng an die des jungen Polizisten geknüpft ist. Die 30-minütige Fahrt aus dem Rotlichtviertel Manilas in einen ruhigeren Vorort hat Mendoza in Echtzeit gefilmt, die Straßen und Lichter der Stadt ziehen scheinbar endlos vorüber, während am Boden die geknebelte Frau stöhnt und wimmert. Die Gangster lassen in ihren Kommentaren keinen Zweifel, dass sie etwas Schreckliches mit ihr vorhaben und so sitzt Peping auf seinem Sitz, geschockt, gelähmt, zweifelnd, was er tun soll. Er bekommt eine Gelegenheit zur Flucht, um Hilfe zu holen, er zögert aber und lässt sie verstreichen. Es sind quälende Minuten, in denen der Regisseur den Zuschauer ganz mit Peping und seinem moralischen Konflikt alleine lässt, ohne ihm auch nur den Hauch von Distanz zu ermöglichen.

Was Mendoza in Cannes von Roger Ebert und anderen vorgeworfen wurde, war neben technischen Argumenten wie der angeblich unprofessionellen Beleuchtung und Wackelkamera in den Nachtszenen, vor allem die Brutalität und der angebliche Zynismus, mit der der Regisseur der im Film gezeigten Gewalt gegenüberstehe. Kinatay ist allerdings weder brutal, noch zynisch und auch nicht wirklich pessimistisch, er ist im Gegenteil ein zutiefst moralischer und engagierter Film. Dass man die Vergewaltigung, Ermordung und Zerstückelung einer jungen Mutter ohne ironische Brechung, ohne splatterhafte Übertreibung und ohne Verfremdung zeigen kann, dass man noch dazu rigoros und ohne Distanz den Blickwinkel eines erst unfreiwilligen, aber eben doch beteiligten Helfers einnimmt, das scheint offenbar viele Zuschauer zu verstören. Dass die Eskalation von Gewalt und Folter etwas Beiläufiges hat, ist nicht zynisch, sondern ehrlich. Man sollte sich immer wieder vor Augen führen, dass das, was Mendoza zeigt, eigentlich keine mystifizierte Reise ins „Herz der Finsternis“ ist (wie viele Kritiker in ihren Besprechungen suggerierten), die man danach mit einem wohligen Schaudern wieder von sich stoßen kann. Nicht umsonst hat er gerade die düsteren Szenen in HD gedreht, ein Material das man fast instinktiv mit Adjektiven wie „realistisch“ und „dokumentarisch“ in Verbindung setzt, demgegenüber die Szenen am Tag in gestochenem 35mm schon eher etwas Unwirkliches an sich haben. Die Gewalt, die Mendoza zeigt, ist schlicht Alltag – Alltag in Manila, aber auch überall sonst auf der Welt. Und so sehr der Film auch ein Porträt der philippinischen Gesellschaft ist, der Korruption, dem Alltag zwischen postkolonialer Moderne und nur oberflächlich verdrängter Gewalt, so ist er in seinem Kern universal. Die gesellschaftliche und finanzielle Abhängigkeit, die die ethischen Werte des Einzelnen untergräbt, und der fehlende Widerstand dagegen, der sie unwiederbringlich zerstört, das ist kein Thema, das sich auf die Philippinen beschränkt. Dabei ist Kinatay in der Wahl seiner Mittel eigentlich ein einfacher, recht unspektakulärer Film. Was ihn interessant macht, ist die Unbeirrtheit und die Gnadenlosigkeit, mit der Mendoza verdrängte Mechanismen der Gewalt – in der Gesellschaft und in jedem Einzelnen – beobachtet und ans Licht holt. Die Aufregung, die er verursacht hat, liegt vielleicht tatsächlich darin begründet, dass der Film den Zuschauer involviert, ihm keine Ausflüchte und kein Verdrängen lässt, sondern die inneren Konflikte Pepings zu denen des Publikums macht, dass sich den implizierten moralischen Fragen selbst stellen muss.
Es ist wohl leider nicht zu erwarten, dass Kinatay eine große Festival- und Kinokarriere beschieden sein wird, trotz oder wegen des Theaters in Cannes. Umso verdienstvoller, dass das Münchner Filmfest ihn dieses Jahr in seiner neuen Fokus Fernost-Reihe laufen ließ und Mendoza schon seit Jahren fördert und immer wieder einlädt – 2009 gab es mit Serbis sogar noch einen zweiten seiner Filme im Programm. Auf den Philippinen selbst wurde Kinatay zunächst mit einem Aufführungsverbot belegt (Mendoza hat inzwischen erreicht, dass es für fünf Jahre ausgesetzt wird) und auch im westlichen Festival- und Arthausbetrieb, in dem Publikum und Macher nach mehr Realismus im Weltkino rufen und damit meist leider doch nur mehr Selbstbestätigung und Exotismus meinen, wird einem wirklich unbequemen Film wie Kinatay wohl leider nur eine Randstellung beschieden sein.
Der Hollywood Reporter analysiert jedenfalls schon mal in der ihm eigenen, in seiner vollständig auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten schonungslosen Offenheit: “Unlike such other Mendoza works as „Foster Child“ or „Serbis,“ which capture with warmth or exotic social phenomena distinctive to the Philippines, „Kinatay’s“ sketchy slice of crime world nastiness can be found anywhere. This makes it a hard sell even to art houses, as their target audience often looks for stronger cultural flavor.”

„‚It seems very pretty‘ she said when she had finished it, ‚but it’s rather hard to understand!'“
Mit diesem von Alice auf das rätselhafte Gedicht „Jabberwocky“ gemünzten Zitat aus Lewis Carrolls „Through the Looking Glass“ (1872) beginnt „MALPERTUIS“, das Wunschprojekt des Flamen Harry Kümel, den man wohl als filmischen Vertreter des belgischen magischen Realismus bezeichnen könnte, eine Stilrichtung die die Nachkriegsliteratur dieses Landes stark prägte.
Genau wie Carolls tiefsinnigen Nonsens prägt auch Kümels Verfilmung des gleichnamigen Romans (1943) von Jean Ray, dem „belgischen Poe“ das Paradox der Unmöglichkeit gleichzeitig zu erleben und zu begreifen, von Unmittelbarkiet und Reflektion und die verschachtelte Struktur des Films mündet am Ende in den selben Schlussgedanken wie Carrolls zweites Alice-Abenteuer: „Life, what is it but a dream?
Der Matrose Jan (Mathieu Carrière), kommt nach langer Zeit auf See in seiner Heimatstadt an, doch es ist keine Heimkehr des Odysseus, der nach langer Irrfahrt nur eben noch zu Hause in Ithaka Ordnung schafft. Vielmehr begleiten wir staunenden Zuschauer den Seemann nun auf seiner gerade erst beginnenden, sozusagen oneironautischen („traumfahrerischen“) Reise in die labyrinthische Welt von Malpertuis (=“Fuchsbau“), dem unheimlichen Anwesen seines Onkels Cassavius, gespielt von niemand geringerem als Orson Welles, der wohl am Set äußerst unleidlich und betrunken gewesen sein und sich nur mit Regisseur Kümel vertragen haben muss.
Zunächst gerät Jan auf der merkwürdigerweise vergeblichen Suche nach seinem Elternhaus in den nebelverhangenen und fast menschenleeren Gassen von Brügge in den bizarr-bunt ausgestatteten Venus-Club, als er einer Frau in einem wallenden blauen Mantel nachrennt, die er für seine Schwester Nancy (Susan Hampshire) hält. Dabei wird er selbst von zwei rätselhaften Männern beobachtet, die ihm seit seiner Ankunft am Hafen folgen. Er gerät in eine Schlägerei, bei der er niedergeschlagen wird und wacht in den Armen seiner Schwester Nancy, mit der er ein fast inzestuöses Verhältnis zu haben scheint, im Haus seines Onkels Cassavius auf: Malpertuis.

Voller Schrecken darüber, an diesem Ort zu sein, will Jan sofort aufbrechen, doch schließlich überzeugt ihn sein anderer Onkel Charles Dideloo (genial neckisch: Michel Bouquet) zumindest der Verkündung des Testaments des im Sterben liegenden Cassavius beizuwohnen. Nach und nach begegnet Jan den vielen in Malpertuis wohnenden Gestalten, deren bloße profane Menschlichkeit durch ihre geheimnisvolle und teils beängsitgenden Aura eher fraglich ist. Als es zur Testamentverlesung durch den langbärtigen Hausdiener Eisengott (Walter Rilla) kommt, erwartet alle eine unangenehme Überraschung: wer etwas von dem reichhaltigen Erbe erhalten will, darf Malpertuis nie mehr verlassen…
Die zunehmend verworrener werdende Handlung ist im Grunde genommen nur ein loses Gerüst für die märchenhaften und unheimlichen Phantasmagorien die Kümel hier entfesselt: Erotische Begierden in kerzenerleuchteten Bibliotheken, Türen die mal in dieses, mal in ein anderes Zimmer führen, ein etwas übereifriger Taxidermist und schmelzende Kruzifixe sind nur einige der Kuriositäten die uns Kümel in wunderschön komponierten Bilder des späteren „Highlander“-Kameramanns Gerry Fisher vorsetzt und mit unaufdringlicher und subtiler Musik von Georges Delerue („L’important c’est d’aimer“) unterlegt.

Nicht nur für alle Enthusiasten des phantastischen Kinos ist „Malpertuis“ ein wahres Juwel, das seinerzeit zwar in Cannes wie viele große Filme durchfiel, aber zu einem Geheimtipp avancierte und angeblich auch in Deutschland recht gut im Kino lief. Nach „Daughters of Darkness“ (1971) ist dies nun schon das zweite Meisterwerk des (halb)vergessenen Harry Kümel, dass ich gesehen habe und ich freue mich schon auf „De komst van Joachim Stiller“ (1976), das sich als das dritte entpuppen könnte.

Manchmal bringt einem auch die Überzeugung, dass auch zu den problematischten Filmen auf die ein oder andere Weise vielleicht doch ein Zugang zu finden wäre, der sie wenigstens bis zu einem bestimmten Maß zu ihrem Recht kommen lässt, sowie der Wille, eher nach den gelungenen als den misslungenen Seiten zu suchen, nichts mehr. Wider Erwarten ist der neue Film von Jim Jarmusch ein solcher Fall. Nicht, dass ich ein übermäßig großer Jarmusch-Fan wäre (habe allerdings auch nichts gegen ihn), aber der Trailer machte mir tatsächlich viel Lust auf den Film, während der Verriss von Roger Ebert und die Abweisung des Films in Cannes nicht wirklich abschreckten, sondern eher zusätzlich neugierig machten. Viel mehr hatte ich vorab nicht mitbekommen, weil es sich nicht selten als sinnvoll erweist, die eigene Rezeption nicht durch allzu ausgiebige Vorab-Informationen ungewollt im Übermaß beeinflussen zu lassen. Geändert hätte es wohl nichts daran, dass mir „The Limits of Control“ vollkommen schal und tot erscheint. Ein lebloses Konstrukt. Was nicht zwingend etwas schlechtes sein muss, weil sich auch unter einer solchen Maßgabe auf vielerlei Weise Gewinnbringendes entwickeln kann. Das Potenzial dazu ist auch im vorliegenden Fall fast durchgehend vorhanden. Es geht in weiten Teilen des Films um nicht viel mehr als einen mysteriösen namenlosen Mann, der viel läuft und wartet und Kaffee trinkt und gelegentlich andere mysteriöse namenlose Menschen trifft – dann werden Streichholzschachteln ausgetauscht und ein Weisheit suggerierender Spruch gereicht, und das alles in einer Darbietung, die Brücken zu Gangster-, Agenten-, Rache- oder Auftragskiller-Filmen, bevorzugt lakonischer französischer Art, zu schlagen versucht. Dieser äußerst reduzierte inhaltliche Minimalismus, die exzessive Stilisierung des Films und sein verblüffend umfassender Verzicht auf Psychologisierung wären ein ausgezeichneter Ansatz zu einer Reflexion über Zeichensysteme, über Codierungen filmischer Narration und Genre-Mechanismen gewesen.
Ein konsequentes Überdrehen der Ästhetik ins Abstrakte, ins Surreale oder zumindest Ambivalente hätte den Stil dabei womöglich ein tragendes Eigenleben entwickelt lassen, in der tatsächlichen Ausführung jedoch läuft die Gestaltung schnell zielsicher auf einen Nullpunkt zu, der keine Möglichkeiten mehr eröffnet und kein Interesse generiert. Die Bilder und Kompositionen lassen an ihrem glatten, öden Hochglanz-Chic alles abperlen, sind in ihrer Leblosigkeit nur noch Behauptung und Demonstration. Bei einer anderen Arbeit von Kameramann Christopher Doyle, „Invisible Waves“, nannte Cargo- und Perlentaucher-Kritiker Ekkehard Knörer eine nicht unähnliche Art der Bebilderung „totgeboren“, was wohl recht treffend ist, mir im dortigen Fall allerdings noch ausgesprochen funktional und erstaunlich stimmig im Sinne einer Entsprechung und Übersetzung von Innen- in Außenwelten erschien (zugegebenermaßen hat ein Zweitsichtungsversuch Zweifel an diesem Eindruck entstehen lassen). Bei „The Limits of Control“ wiederum schlägt all das Gewollte und Drapierte, das um seiner selbst Willen Eingerichtete, Dekorierte, Ausgestellte voll durch, weil der Film sich nicht für Innenwelten, Emotionen oder Zustände interessiert (für Motivation oder Psychologie ohnehin nicht, wobei das keineswegs ein grundsätzlicher Nachteil ist) und zudem mit seiner Absage an jede Art von Lebendigkeit und (sozialem) Wahrhaftigkeitsgehalt dieser Praxis der Bebilderung erst recht den Resonanzboden entzieht, sie stattdessen an einen Gesamtzusammenhang verweist, in den sie sich kaum fügen will, so sehr wie jedes Bild nur für sich selbst steht und nur auf sich selbst gerichtet ist. Die penetrante, plumpe Aufdringlichkeit der (wenigen) Dialoge und der erzählerischen Struktur, die inhaltliche und formale Abläufe immer wieder als nicht zu hinterfragenden, klugen Einfall heraus zu kehren und als nur allzu bewusstes und beabsichtigtes Mittel zu betonen versucht, macht es nicht besser. Weil den Bildern zudem jede Offenheit zum Entrückten, alles Schwebende und Fließende und Uneindeutige abgeht, prallt auch die vom Film und seinen Figuren immer wieder nahegelegte (richtiger: gepredigte) Bedeutungs- und Möglichkeitenvielfalt, etwa ins Eingebildete oder Träumerische hinein, an ihrer sterilen, starren Oberfläche ab. Inhalt und Form lassen jede Kreativität, jeden Einfallsreichtum vermissen, von Verspieltheit ganz zu schweigen. Es ist noch nicht einmal so, dass ich die Dekoration um ihrer Selbst Willen prinziell ablehnen würde (im Gegenteil kann sich daraus mit der entsprechenden Originalität und Leidenschaft Tolles entwickeln), aber in diesem kalten Hochgestylten ist keine Lust, keine Experimentierfreude, kein Fetischismus, stattdessen lediglich Leere und ein mit punktuell forcierter Bedeutungsschwere angereichertes, konstruiertes, uninspiriertes Nichts ohne innere Spannung, ohne Faszinationskraft, Bewegung, Dynamik, Intensität.
Eine Totgeburt, fürwahr, die sich spätestens ab der Hälfte zum quälend öden Ärgernis auswächst und jede Lust erlahmen lässt, sich die nichtsdestotrotz mitschwingenden bzw. aufgedrückten Diskurse (ob zur Philosophie oder zur Genre-Historie, denn selbst die Verweise zum Gangsterfilm à la Melville kommen kaum über die Behauptung hinaus) doch irgendwie zu erkämpfen. In seinem Präsentationsduktus ist der Film fast noch schlimmer als die jüngsten Werke von Kim Ki-Duk, und im Gegensatz zu den letzten Ausfällen von Coppola oder Argento noch nicht einmal mit Humor zu nehmen, nicht trotz, sondern gerade wegen all der hier weiterhin vorhandenen technischen Professionalität, die aber den Spielraum des Zuschauers eben nicht erweitert, sondern bis zum Ersticken verengt und limitiert. Kurzum: der Tiefpunkt meines bisherigen Kinojahres, nicht nur eine saftige Enttäuschung, sondern ein Totalausfall, der in der zweiten Hälfte zur Unerträglichkeit tendiert.
(Nachtrag: kurios, dass ich zwar an Knörers „Invisible Waves“-Text dachte, mir aber glatt entging, dass er, wie ich mir eigentlich spätestens nach Ansicht des Films hätte denken können, auch bereits zu „The Limits of Control“ einen Verriss mit ähnlichem Tenor schrieb – und dabei so präzise die entscheidenden Punkte trifft, dass ich mir wohl fast die Hälfte meines Textes hätte sparen und darauf verweisen können. Was soll’s, von diesem Film kann ohnehin nicht oft genug abgeraten werden.)