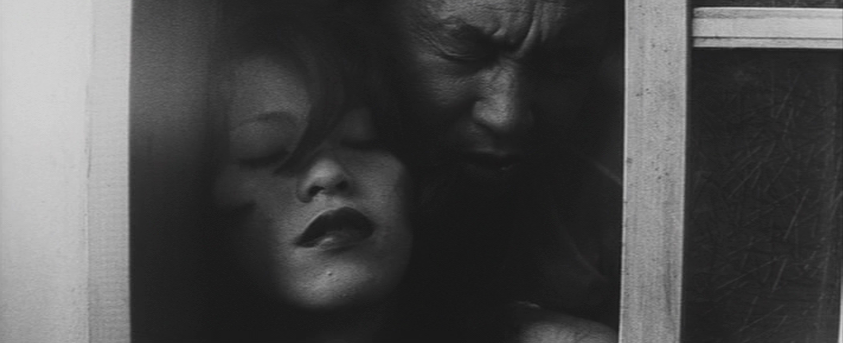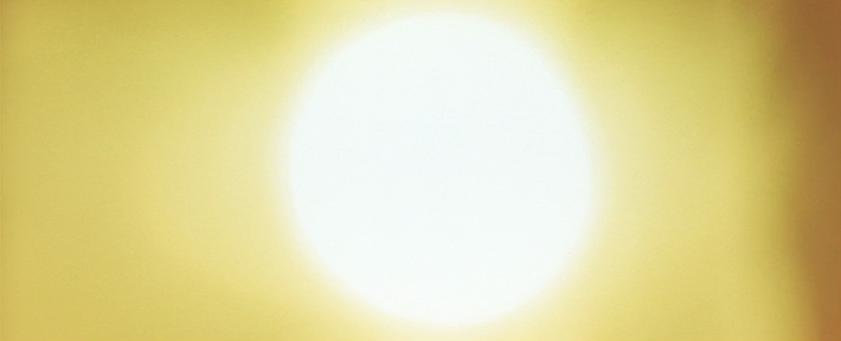„I think Nikkatsu’s position in the industry is unique. It’s a large company, but we worked on one single concept, sex, for 18 years, and made a very large number of films. Having sex is an activity where we clearly show our true natures. Examining the relationships between men and women is one of the best ways to show the essence of human beings. So we thought that by working with the theme of sex, we could explore ourselves more deeply and express the very core of the world.“ – Noboru Tanaka


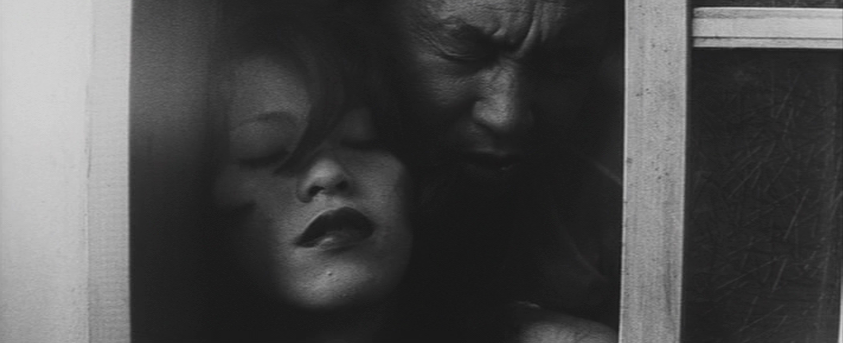









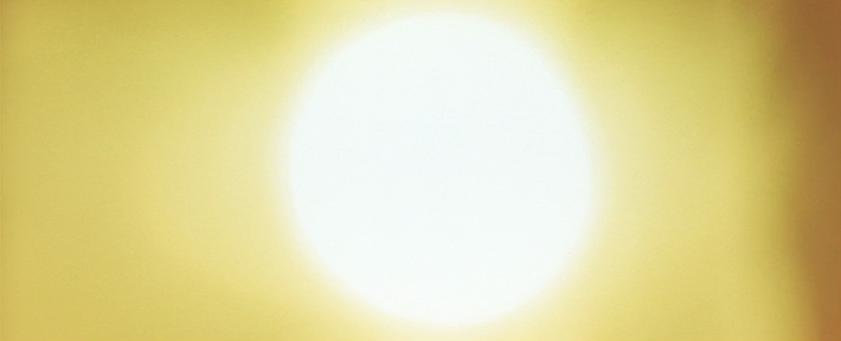


(Maruhi) shikijô mesu ichibar – Japan 1974 – 83 Minuten – Regie: Noboru Tanaka – Produktion: Yoshihiro Yuhki – Drehbuch: Akio Ido – Kamera: Shohei Ando – Musik: Yasuo Higuchi – Schnitt: Shinya Inoue – Szenenbild: Gunji Kawasaki – Darsteller: Meika Seri , Junko Miyashita, Genshu Hanayagi, Moeko Ezawa, Sakumi Hagiwara, Shiro Yumemura, Akira Okamoto, Akira Takahashi, Hyôe Enoki, Ikunosuke Koizumi, Nagatoshi Sakamoto, Kenji Shimamura, Kunio Shimizu, Saburô Shôji
Nach Christophs vorhergehendem wunderbarem STB-Ausrutscher-Langtext-Posting, habe ich mir überlegt es ihm wenigstens im Ansatz gleichzutun, und einen von mir noch ausstehenden STB-Kommentar (aus der problematischen Zeit vor unserem Providerwechsel) etwas auszubauen, und ebenfalls auf den Blog zu stellen. Eigentlich versuche ich ja meist nur Texte zu veröffentlichen, die aus einer Kombination aus Inspiration und Arbeit zu einem für mich zufriedenstellenden Ergebnis geführt haben, aber in diesem Fall möchte ich eine Ausnahme machen. Ich brauche nämlich einen Motivationsgrund anstelle einer möglichen Schreibblockade, die mich nach einem blöden Unfall vor ein paar Tagen aus Frustration überkommen hat. Statt einem längeren Eskalierende Träume Essay über einen älteren thailändischen Film der mir sehr imponiert hatte, gab es bei mir nach dem Stolpern über ein Stromkabel dank OpenOffice bug nur den kompletten Datenverlust und ein unlesbares Dokument zu begutachten, das sich auch nach mehreren Stunden herumklempnern nicht mehr reparieren ließ. Aus Vorsicht und Mißtrauen daher, erst einmal eine Sehempfehlung eines tollen japanischen Films, der mich vor ein paar Wochen überraschend zu begeistern wusste, bevor ich mich wieder an Texte wage, die mir mehr am Herzen liegen.
Weiterlesen…

Zurzeit findet im österreichischen Filmmuseum noch bis zum 30. November eine umfangreiche Werkschau des japanischen Filmregisseurs Nagisa Oshima statt. Sie umfasst (beinahe) alle Kinofilme, sowie einen seiner zahlreichen Fernsehfilme. Zeitgleich zum Auftakt der Retrospektive, veröffentlichte der österreichische Film- und Videovertrieb polyfilm am 06. November den ersten Titel einer 22 Filme unfassenden Reihe „Japanische Meisterregisseure“ auf DVD: Oshimas „Das Grab der Sonne“ (1960). Die ersten 4 Filme der Reihe sind Oshimas Schaffen gewidmet und sollen noch dieses Jahr erscheinen, darunter mit „Die Nacht des Mörders“ (1967) auch eine weltweite Erstveröffentlichung auf DVD.
Zum Auftakt der Retrospektive sprachen Olaf Möller und Roland Domenig vor der Vorführung von Oshimas „Nacht und Nebel über Japan“ (1960) über das vielschichtige Werk des inzwischen 77-jährigen Veteranen des japanischen Kinos, der aufgrund mehrerer erlittener Schlaganfälle wohl nicht mehr in der Lage sein wird weitere filmische Arbeiten zu vollenden. Oshimas Regietätigkeit erstreckte sich von 1959 bis ’99 und umfasste ein breites Ausdrucksspektrum, vom Animationsfilm über assoziativ-essayistische Ansätze bis zum „reinen“ Dokumentar- und Spielfilm. Obwohl er in den 60er und 70er Jahren unter Kennern im In- und Ausland allgemein als wichtigster Vertreter einer neuen Generation von jungen japanischen Filmschaffenden galt, die unter dem vielschichtigen Label der „Neuen Welle“ weltweit Anerkennung fanden, ist sein heutiger Einfluß wohl eher gering einzuschätzen. In Japan fand sich bis zum Erscheinen Takashi Miikes kaum ein Filmemacher der in der Lage gewesen wäre die innovativen formalen und inhaltlichen Konzeptionen von Oshimas Kino weiterzuführen. Im Ausland wurde wiederum lediglich wenigen ausgewählten Filmen der Weg auf Festivals und Kinoleinwände ermöglicht, so dass sich die Vielschichtigkeit seines Werkes den meisten Filmliebhabern nicht erschließen konnte. Oszillierend zwischen sinnlichem Rausch der Extreme und asketischer Sezierung sozialer Zustände, war Oshima immer bereit das Experiment und die Uneinheitlichkeit zu suchen. Die Heterogenität als Konzept, die Vielfalt als Programm verfolgend lassen sich seine Filme im Niemandsland zwischen Genrekinoinspirierten Sex & Crime-Geschichten und abstraktem Kunstfilm einordnen. Das viele von Oshimas Filmen auch heute noch einen „Skandal“ darstellen da sie nur wenig ihrer gesellschaftlichen und ästhetischen Relevanz eingebüßt haben, muß vielerorts erst noch erkannt werden. Wie bei so manchem ehemals hochgelobten Regisseur gilt auch hier: „Mittlerweile muss man Ōshima regelrecht wiederentdecken.“
Persönlich habe ich Oshima vor ziemlich genau zwei Jahren auf der Viennale im Rahmen der genialen Retrospektive Der Weg der Termiten (kuratiert von Jean-Pierre Gorin, einem noch um vieles unbekannteren renommierten Filmemacher) durch „The Man Who Left His Will on Film“ (1970) für mich „wiederentdeckt“. Nicht zuletzt wegen der brillanten Filmkopie geriet die Vorstellung im Saal des Filmmuseums für mich wohl zum bemerkenswertesten Kinoerlebnis des Jahres. Ich würde dieser Tage sehr gerne noch einmal nach Österreich reisen um wieder einen Oshima im Kino sehen zu können. Leider wird das aus zeitlichen und finanziellen Gründen diesmal wohl eher nicht klappen. Daher bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal schriftlich bei den Verantwortlichen von Polyfilm mit deren Veröffentlichungen ich mir (neben zahlreichen Western) den Winter vetreiben werde. Den ersten Film habe ich heute bereits gekauft.
Der Tod als Flucht. Die Bewegung als Flucht. Der Gedanke als Flucht.

Der Film ist gezeichnet von Fluchtbewegungen, von der geistigen Impotenz bzw. der Omnipotenz seiner geprägten Strukturen, letzten Endes von der Unmöglichkeit der Flucht vor sich selbst.
Die Verzweiflung als Zustand des Menschen in der Welt, folgt aus der Identifizierung mit der zugewiesenen oder auserwählten gesellschaftlichen Rolle innerhalb dieser, endet aber nicht in der Erkenntnis der Verflechtung mit den Menschen, sondern manifestiert sich zum dauerhaften Problem des „das ist so gewesen“. Die Macht des Tabus wirkt über Generationen, lässt sich auch rationalisieren, passt sich den jeweiligen Glaubensstrukturen an.

Sünde als Erfindung der Gesellschaft. Schuld als regressives Verhalten. Die Unfähigkeit Dinge zu sehen wie sie sind. Der Zwang nach Sinn und Struktur. Moral als Repressionsmittel der Macht. Das Tabu als Grundlage der Moral. Nicht richtiges handeln, sondern das Falsche definiert sie. „Du sollst nicht“, statt „du sollst“. Sozial legitimiertes moralisches Handeln leitet sich somit aus der Vermeidung des Unmoralischen ab.

Der Film zeigt das Ende der Utopien die mit den japanischen Studentendemonstrationen der 60er einhergingen. Der Machtlose ist an seine Machtlosigkeit gefesselt, wie das Kind an die Mutter. Nicht der Mensch stützt sich gegenseitig, sondern das Glaubenssystem in das man hineingeboren wurde bietet Halt. Gewalt als legitimer Akt der Mächtigen – Gewalt braucht Legitimation. Wo diese fehlt, fehlt die Struktur, fehlt der Halt.

Wie kann man ein Anderer werden? Bei Wakamatsu ist das kaum möglich. Die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln.
Das ist das wirklich schockierende an den Filmen Wakamatsus – die Darstellung einer kollektiven Psychose in der wir alle gefangen sind, ohne Lösung, ohne Ausflucht, ohne Katharsis. Durch den eigenwilligen formalen Aufbau wird diese klaustrophobische Situation noch unterstützt. Das scheinbare Aufbrechen klassischer Regeln und Strukturen, ohne jedoch selbige grundsätzlich in Frage zu stellen. Denn erzählt wird eben doch. Immer noch. Ein Zwang eben. Eine Flucht.

Die Rebellion geschieht dann auch nicht unbedingt auf der Ebene der Figuren, sondern auf der Ebene des Films. Im Nachklingen, im sich nicht vollständig erklären lassen wollen, im verweigern eines sauberen Abschlusses. Gerade durch die Erkenntnis der Zwänge und Beschränktheit menschlichen Handels und ihrer Zurschaustellung, wird es dem Zuschauer möglich Zusammenhänge zu verstehen die die Protagonisten nicht überblicken, Wahrheiten auszuhalten an denen die Figuren zerbrechen. Die Rebellion als Utopie – nach dem Film.
Kyôsô jôshi-kô – Japan 1969 – 72 Minuten – Regie, Produktion und Schnitt: Kôji Wakamatsu – Drehbuch: Masao Adachi, Izuru Deguchi – Kamera: Hideo Itoh – Musik: Takehito Yamashita – Darsteller: Ken Yoshizawa, Yoko Muto, Rokko Toura, Hatsuo Yamaya, Shigechika Sato, Masao Adachi

Manchmal bringt einem auch die Überzeugung, dass auch zu den problematischten Filmen auf die ein oder andere Weise vielleicht doch ein Zugang zu finden wäre, der sie wenigstens bis zu einem bestimmten Maß zu ihrem Recht kommen lässt, sowie der Wille, eher nach den gelungenen als den misslungenen Seiten zu suchen, nichts mehr. Wider Erwarten ist der neue Film von Jim Jarmusch ein solcher Fall. Nicht, dass ich ein übermäßig großer Jarmusch-Fan wäre (habe allerdings auch nichts gegen ihn), aber der Trailer machte mir tatsächlich viel Lust auf den Film, während der Verriss von Roger Ebert und die Abweisung des Films in Cannes nicht wirklich abschreckten, sondern eher zusätzlich neugierig machten. Viel mehr hatte ich vorab nicht mitbekommen, weil es sich nicht selten als sinnvoll erweist, die eigene Rezeption nicht durch allzu ausgiebige Vorab-Informationen ungewollt im Übermaß beeinflussen zu lassen. Geändert hätte es wohl nichts daran, dass mir „The Limits of Control“ vollkommen schal und tot erscheint. Ein lebloses Konstrukt. Was nicht zwingend etwas schlechtes sein muss, weil sich auch unter einer solchen Maßgabe auf vielerlei Weise Gewinnbringendes entwickeln kann. Das Potenzial dazu ist auch im vorliegenden Fall fast durchgehend vorhanden. Es geht in weiten Teilen des Films um nicht viel mehr als einen mysteriösen namenlosen Mann, der viel läuft und wartet und Kaffee trinkt und gelegentlich andere mysteriöse namenlose Menschen trifft – dann werden Streichholzschachteln ausgetauscht und ein Weisheit suggerierender Spruch gereicht, und das alles in einer Darbietung, die Brücken zu Gangster-, Agenten-, Rache- oder Auftragskiller-Filmen, bevorzugt lakonischer französischer Art, zu schlagen versucht. Dieser äußerst reduzierte inhaltliche Minimalismus, die exzessive Stilisierung des Films und sein verblüffend umfassender Verzicht auf Psychologisierung wären ein ausgezeichneter Ansatz zu einer Reflexion über Zeichensysteme, über Codierungen filmischer Narration und Genre-Mechanismen gewesen.
Ein konsequentes Überdrehen der Ästhetik ins Abstrakte, ins Surreale oder zumindest Ambivalente hätte den Stil dabei womöglich ein tragendes Eigenleben entwickelt lassen, in der tatsächlichen Ausführung jedoch läuft die Gestaltung schnell zielsicher auf einen Nullpunkt zu, der keine Möglichkeiten mehr eröffnet und kein Interesse generiert. Die Bilder und Kompositionen lassen an ihrem glatten, öden Hochglanz-Chic alles abperlen, sind in ihrer Leblosigkeit nur noch Behauptung und Demonstration. Bei einer anderen Arbeit von Kameramann Christopher Doyle, „Invisible Waves“, nannte Cargo- und Perlentaucher-Kritiker Ekkehard Knörer eine nicht unähnliche Art der Bebilderung „totgeboren“, was wohl recht treffend ist, mir im dortigen Fall allerdings noch ausgesprochen funktional und erstaunlich stimmig im Sinne einer Entsprechung und Übersetzung von Innen- in Außenwelten erschien (zugegebenermaßen hat ein Zweitsichtungsversuch Zweifel an diesem Eindruck entstehen lassen). Bei „The Limits of Control“ wiederum schlägt all das Gewollte und Drapierte, das um seiner selbst Willen Eingerichtete, Dekorierte, Ausgestellte voll durch, weil der Film sich nicht für Innenwelten, Emotionen oder Zustände interessiert (für Motivation oder Psychologie ohnehin nicht, wobei das keineswegs ein grundsätzlicher Nachteil ist) und zudem mit seiner Absage an jede Art von Lebendigkeit und (sozialem) Wahrhaftigkeitsgehalt dieser Praxis der Bebilderung erst recht den Resonanzboden entzieht, sie stattdessen an einen Gesamtzusammenhang verweist, in den sie sich kaum fügen will, so sehr wie jedes Bild nur für sich selbst steht und nur auf sich selbst gerichtet ist. Die penetrante, plumpe Aufdringlichkeit der (wenigen) Dialoge und der erzählerischen Struktur, die inhaltliche und formale Abläufe immer wieder als nicht zu hinterfragenden, klugen Einfall heraus zu kehren und als nur allzu bewusstes und beabsichtigtes Mittel zu betonen versucht, macht es nicht besser. Weil den Bildern zudem jede Offenheit zum Entrückten, alles Schwebende und Fließende und Uneindeutige abgeht, prallt auch die vom Film und seinen Figuren immer wieder nahegelegte (richtiger: gepredigte) Bedeutungs- und Möglichkeitenvielfalt, etwa ins Eingebildete oder Träumerische hinein, an ihrer sterilen, starren Oberfläche ab. Inhalt und Form lassen jede Kreativität, jeden Einfallsreichtum vermissen, von Verspieltheit ganz zu schweigen. Es ist noch nicht einmal so, dass ich die Dekoration um ihrer Selbst Willen prinziell ablehnen würde (im Gegenteil kann sich daraus mit der entsprechenden Originalität und Leidenschaft Tolles entwickeln), aber in diesem kalten Hochgestylten ist keine Lust, keine Experimentierfreude, kein Fetischismus, stattdessen lediglich Leere und ein mit punktuell forcierter Bedeutungsschwere angereichertes, konstruiertes, uninspiriertes Nichts ohne innere Spannung, ohne Faszinationskraft, Bewegung, Dynamik, Intensität.
Eine Totgeburt, fürwahr, die sich spätestens ab der Hälfte zum quälend öden Ärgernis auswächst und jede Lust erlahmen lässt, sich die nichtsdestotrotz mitschwingenden bzw. aufgedrückten Diskurse (ob zur Philosophie oder zur Genre-Historie, denn selbst die Verweise zum Gangsterfilm à la Melville kommen kaum über die Behauptung hinaus) doch irgendwie zu erkämpfen. In seinem Präsentationsduktus ist der Film fast noch schlimmer als die jüngsten Werke von Kim Ki-Duk, und im Gegensatz zu den letzten Ausfällen von Coppola oder Argento noch nicht einmal mit Humor zu nehmen, nicht trotz, sondern gerade wegen all der hier weiterhin vorhandenen technischen Professionalität, die aber den Spielraum des Zuschauers eben nicht erweitert, sondern bis zum Ersticken verengt und limitiert. Kurzum: der Tiefpunkt meines bisherigen Kinojahres, nicht nur eine saftige Enttäuschung, sondern ein Totalausfall, der in der zweiten Hälfte zur Unerträglichkeit tendiert.
(Nachtrag: kurios, dass ich zwar an Knörers „Invisible Waves“-Text dachte, mir aber glatt entging, dass er, wie ich mir eigentlich spätestens nach Ansicht des Films hätte denken können, auch bereits zu „The Limits of Control“ einen Verriss mit ähnlichem Tenor schrieb – und dabei so präzise die entscheidenden Punkte trifft, dass ich mir wohl fast die Hälfte meines Textes hätte sparen und darauf verweisen können. Was soll’s, von diesem Film kann ohnehin nicht oft genug abgeraten werden.)