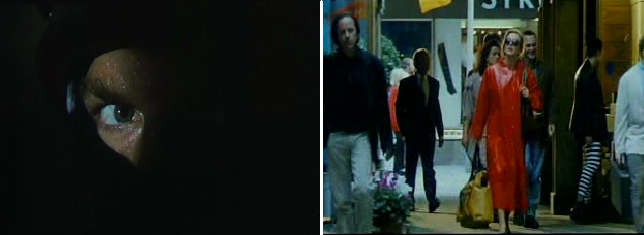„Ein großer, frecher, heißer Film, der einem die Augen aufreißt.“ (Rheinische Post)
„Ein provozierendes und polarisierendes Bilder-Mosaik, komponiert aus einem manifesten, anarchischen Stilwillen von einem jungen Wilden aus dem Berliner Underground.“ (Frankfurter Rundschau)
„Kahl hat eine nervöse Energie, die ihm im deutschen Kino so leicht keiner nachmacht.“ (Süddeutsche Zeitung)
RP Kahl, der den meisten Zuschauern wohl eher als Nebendarsteller aus zahlreichen Fernsehfilmen bekannt sein sollte (ich habe ihn zuletzt in Michael Kliers Farland (2003) in einer Kleinstrolle an der Seite von Laura Tonke entdeckt), ist auch Regisseur. Und seinen Einstieg begann er sogleich mit einem Kinofilm. Angel Express hieß das Ding, 1998 herausgebracht – ein Beginn, der keiner wurde. Kahl hat erst 2010 wieder einen Spielfilm realisieren können. Dazwischen Projekte, Versuche, Theater, Video, Performance, die 99Euro-Films und im Zuge davon auch ein wunderbarer dokumentarischer Streifen über vier deutsche Schauspielerinnen, Mädchen am Sonntag. Andere Filmemacher der 90er sind erfolgreicher gewesen, wiederum andere sind zur Filmhochschule gegangen und haben danach überhaupt nichts mehr gemacht. RP Kahl ist einer der ungebändigten, ungezügelten, nach wie vor enthusiastischen. Einer, der sich nicht vom Establishment vereinnahmen lassen will und seinen eigenen Weg zu gehen versucht. Ein deutscher Independentfilmer – im besten Sinne. Weiterlesen…

„Ich mach dir Flügel und fick’ ich dich in den Himmel, Schwester Maria.
Ich kann dich auch in die Hölle ficken.
Mein Schwanz kann alles!“
– Lothar, August, Beelzebub
Babylon – Im Bett mit Ralf Huettner
Ein Film in den Wehen. BABYLON, die große Hure Babylon, windet sich im Neonlicht des Kreißsaals und gebiert konvulsivisch Einstellung um Einstellung, jede ihrerseits Wirtin einer neuen. Jeder Schnitt ist eine Entbindung. Das Kino wird zum Mutterleib, die Leinwand zum sich zur Welt öffnenden Spalt, zum Lichttunnel.
Am Ende der Nacht liegt dieser Lichttunnel, am Ende einer flackernden Spirale, in der die Nacht gleißender aussieht und Krankenschwesternuniformen pinker sind als je wieder in einem deutschen Filmerzeugnis. Ach! Das deutsche Kino, sein klinisches Bürofensterlicht… Huettner aber träumt sein Kino dahin, wo Träume zuhause sind – in die Nacht. In seine schlaflose Nacht, in der blinde Tumorpatientinnen in Krankenhäusern unter dem Ächzen von Tennisspielern im Fernsehen lustvoll verglühen, in der Apothekerinnen ihren Nachtdienst absitzen, wartend in der Hoffnung auf einen hilfsbedürftigen Patienten, dem sie die Salbe einreiben können, den sie lebendig mumifizieren können, eine Nacht, in der eine Verständnis versprechende, körperlose Stimme raunt und die Tore zur Ewigkeit sich auf der Müllhalde des Seins auftun.
Der Vertreter Lothar (Dominic Raacke) liebt die Kranken, die Trauernden, die Verlorenen. Sie sind ein gutes Geschäft, ihnen kann man das elektronische Glück verkaufen. Hinter der Unbegreiflichkeit ihrer Schicksalsschläge wittern sie eine böse Macht, inständig hoffend, diese möge sich als etwas Fassbares erweisen, etwas dass man bekämpfen kann, Erdstrahlen zum Beispiel, Wasseradern, Asbest in den Wänden… Gut, dass es Lothar gibt, den geschniegelten Heiland im Anzug mit den heilenden Geräten (sanitas ex machina!) und dem heilen Gerät, mit dem er die Frauen liebt. Auch sie werden von ihm geheilt – von der schrecklichsten Plage, die Gott über Babylon, die Welt, verhängt hat: Dem Dasein. Denn von Lothar schwanger zu sein bedeutet, selbst abgetrieben zu werden. Zuerst platzen die Kondome, später die Frauen. Blutbesudelt wäscht sich die Hebamme rein in einem See vor Pagoden, beobachtet von einem ältlichen weißgrauen Pärchen, das omnipräsente greisenhafte Double Gottes des allsehenden Zuschauers.
Voyeurismus und Exhibitionismus. Als Voyeuristen dürfen wir, zum ersten und einzigen Mal, über Grande Dame Veronica Ferres staunen, die kichernd ihren Busen aus einer Opernloge baumeln lässt. Exhibitionistisch dürfen sich die wurzellos im schwarz gluckernden Ozean der infernalischen Dämmerung treibenden Emotionen präsentieren, die Emotionen der blinden Lesbe, deren Finger den Kehlkopf und die ausladende mama der probenden Opernsängerin ertasten. Ihre Stimme sei, so die Blinde später, als hätte sie irgend etwas im Hals. Vielleicht ist es ja auch ein Tumor, wie er sich im Kopf der Blinden breit macht, eine perverse Wucherung, ein unerwünschter Zellklumpen, ein wiedergängerischer Fötus, der nicht tot zu kriegen ist, vorwitzig aus der Nierenschale glitschend, vielleicht sein Glück in der Welt suchend.
Gierige Hände greifen aus dem Hades nach allem Stetigen in diesem Film. Tragik ist ein Luxus, den frau hier nicht bezahlen kann, weder Maria, noch die kleine blonde banale Krankenschwester Bibi oder die perverse Apothekerin. Wir machen alles schlimmer und das ist gut so, meint Lothar.
In BABYLON drängt alles zum Sturz. Hausmeister müssen die Scherben der zerbrochenen Menschen zusammenkehren, aus denen sie die Verzweiflung anblickt. Babys stürzen durch flammenlodernde Kanäle ins Leben, verwahren sich entschieden gegen ihre provisorische Abtötung zum Schutz vor jenem, den Verrat des Fährmanns im weißen Kittel. Niemand kann sich dem Sog der Tiefe entziehen, auch Maria (Natja Brunckhorst) kann nicht fliegen, obwohl ihr Kleid mit chinesischen Drachen bestickt ist und Lothar ihr Flügel versprochen hatte. Die androgyne Krankenschwester muss den Weg gehen, den wir alle einmal gehen müssen, mit nuttigen Siebenmeilenstiefeln gerüstet für die Flucht ins Embryonale.
BABYLON ist ein oneironautischer Trip, ein cinemanischer Wunschtraum und eine psychosexuelle Welt-Traum-Oper, in der ständig Fassade um Fassade einer urbanen deutschen Halbwelt abbröckelt, Trümmer eines babylonischen Turmes, den Zuschauer erschlagend, Blatt um Blatt eines unendlichen Kartenhauses. Meta-Sleazik des Werdens: Himmel oder Hölle – BABYLON kann alles.
BABYLON – Deutschland 1992 – 85 Minuten – ThanatoColor
Regie: Ralf Huettner – Buch: Andi T. Hoetzel, Ralf Huettner – Produktion: Ralf Huettner, Andi T. Hoetzel, Dominic Raacke – Kamera: Diethard Prengel – Schnitt: Margarete Rose – Musik: One Tongue
Darsteller: Natja Brunckhorst, Dominic Raacke, Michael Greiling, Veronica Ferres, Ditte Schupp, Ina Siefert, Ilse Zielstorff

Eine Theaterbühne, Stimmen aus dem Off. Wir sind bei einer Probe. Wichtig ist jedoch die Inszenierung im Raum, kein Text, sondern Bewegung. Es herrscht Sprachlosigkeit. Die Welt als Bühne, das Leben als Inszenierung, und die Menschen als Statisten. In Eva Hillers faszinierend direktem filmischem Essay geht es um das Funktionieren des Systems, um die technischen Errungenschaften unserer Zivilisation. Um die Geister, die wir riefen, um die Dunkelheit zu bannen, und die wir inzwischen nicht mehr los werden.
Als fieser Zwilling von Chris Markers Sans soleil irgendwo zwischen Nikolaus Geyrhalters Unser täglich Brot und Jürgen Böttchers Rangierer angesiedelt, changiert der Kamerablick immer wieder zwischen Präzision der Kadrierung und Authentizität des Augenblicks, zwischen Travelling Shot und Momentaufnahme, um vor allem die materielle Präsenz der Dinge hervorzuheben, die Gewalt der Oberfläche. Brutal könnte man Kamera und Montage nennen, unbarmherzig, gnadenlos, direkt, denn die Härte des Gezeigten wird in der Inszenierung nicht aufgehoben. Formal werden die Prozesse teilweise nachvollzogen, jedoch ohne ihnen einen konkreten Raum zuzuweisen, ohne die Möglichkeit der Entfaltung. Unmittelbarkeit, Gleichzeitigkeit, Virtualität. Es gibt nichts zu entdecken, alles liegt offen zu Tage, und gerade dadurch überfordern uns die Zeichen und Informationen, die von Maschinen in einer Geschwindigkeit decodiert werden, welche den Moment menschlicher Bewusstwerdung um ein Vielfaches übersteigt, und uns gerade dadurch den evolutionären Prozess der Bewusstseinsbildung permanent schmerzlich vor Augen führt. Die Dinge denken nicht, sie handeln.
Fear and Desire hieß der erste Spielfilm Stanley Kubricks. Die Angst und das Begehren, Furcht und die Erlangung der Macht über die Furcht. Wer die Nacht beherrscht, beherrscht den Tag. Das Kino von Unsichtbare Tage ist, wie das Kino des Stanley Kubrick, ein Kino der Nacht. Und das vielfach benannte Schweigen der Bilder bei Kubrick entpuppt sich durch Hillers Film einfach als das Schweigen des Menschen. Systemzwang, strukturelle Gewalt, die Flucht vor dem Ich, der Wunsch nach Herrschaft über etwas, das sich nicht beherrschen lässt, das Faszinosum, das Paradox der Kontrolle: die ganze Palette von Kubricks Themenkomplexen findet sich in diesem Film wieder, ebenso wie seine Art der Inszenierung. Kubrick in Deutschland? Ja, tatsächlich.
„Schau in die Sonne. Welche Sonne? Na, die Sonne. Ach, das gelbe Ding da oben. Siehst du sie? Aber ja doch, ist doch immer da, seh ich doch immer. Aber schau mal hin, schau mal rein.“ Wenn wir zu lange in die Sonne blicken, erblinden wir. Die Realität die immer vor uns liegt übersehen wir daher bewusst. Denn das Licht der Erkenntnis ist die ständige Präsenz, die immer schon ist, und die uns inzwischen regelmäßig überfordert. Technik ist bei Hiller wie bei Kubrick fahler Ersatz, vergebliche Flucht. Und die Menschheit dadurch ein System, das sich selbst auslöscht. Das Offensichtliche als Offensichtliches präsentieren. Der Leerlauf der Bewegung und die Unmöglichkeit der Ausdehnung des menschlichen Geistes ohne gleichzeitige Ausdehnung des Bewusstseins. Also dehnen wir unsere Körper.
Es ist ein Verschwörungsfilm ohne eigentliche Verschwörung. Ein Film, der vom aus der Zeit fallen erzählt, und dabei selbst aus der Zeit gefallen wirkt. Er hätte auch gestern gedreht werden können, oder morgen. Unsichtbare Tage transportiert keine Ideen, stellt keine Fragen. Er zeigt auf und gibt Antworten. Um dem Tod zu entfliehen, um die Nacht zu zerstören, müssen wir auch den Tag zerstören, müssen wir letztendlich Maschine werden. Also der nächste Schritt in einer Evolution, die die Angst vor der Evolution beseitigen will. Wenn die Sonne eines Tages verglüht ist, glaubt der Mensch weiterleben zu können, indem er die Realität durch die Virtualität ersetzt. Denn wie formuliert es die Sprecherin im Film: Wenn alles Illusion ist, verschwindet die Illusion. Und diese Hoffnung scheint es zu sein, die den Menschen in seiner Flucht vor der Auseinandersetzung mit sich selbst letztlich antreibt.
Unsichtbare Tage oder Die Legende von den weißen Krokodilen – Deutschland 1991 – 75 Minuten – Regie und Produktion: Eva Hiller – Drehbuch: Eva Hiller, Wolfgang Kabisch – Kamera: Thomas Mauch – Musik: Matthias Raue – Schnitt: Stefan Beckers – Ton: Michael Busch – Sprecherin: Renan Demirkan
Bildquelle: derkrieger – http://tinyurl.com/4nmtaq2

Viele Menschen, die in Ulrich Weiß‘ Abstecher interviewt werden sind ehemalige Ostdeutsche. Und viele von ihnen sind sich einig, dass eines im neuen Deutschland etwas verloren gegangen zu sein scheint: die Menschlichkeit. Wie kann es sein, dass Bewohner des Unrechtsstaates DDR, eines Staates der seine Bürger permanent mundtot zu machen versuchte, und jeden Anflug von Individualität als Angriff auf die herrschende Ideologie verstanden haben wollte, ausgerechnet diese Feststellung machen? 1991. Zwei Jahre nach der Wende?
Um diese Frage dreht sich der gesamte Film. Wo bleibt der Einzelne innerhalb revolutionär anmutender Prozesse? Und wie hat sich die Wiedervereinigung auf die Bewohner der ehemaligen DDR wirklich ausgewirkt? Große Teile des Films spielen während einer Zugfahrt von Ost nach West. Die Menschen sind müde, erschöpft, resigniert. Der Aufbruchstimmung nach dem Mauerfall, ist der Wunsch nach bürgerlichen Träumen gewichen. Und die meisten wünschen sich nur noch das mindeste: eine Arbeit zu haben.
Der Film fängt mit einer Fernsehansprache an. 1989: Friedrich Schorlemmer, spricht über Euphorie, Glücksvorstellungen, Neuanfang. Danach: die Gegenwart, 1991, zwei Jahre später. Wieder Schorlemmer, diesmal privat. Die Szene erdrückend, die Enttäuschung groß. Die Utopie einer angeblich freien Gesellschaft, in der der Einzelne mit der Freiheit nichts anfangen kann. Da nun scheinbar alles möglich ist, gibt es nichts mehr zu tun. Die Illusion würde sich gerne als Realität behaupten, doch die Aufnahmen des Films sprechen eine andere Sprache.
Als Friedrich der Große gegen Ende des Films in Potsdam seiner neuen Ruhestätte zugeführt werden soll, sind zahlreiche Gruppierungen angetreten um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Ein Spektakel, das Jeder für sich und seine Interessen ausnutzen möchte, eine Selbstdarstellung, in der die Leichen von Friedrich und seinem Vater als Vorwand für diverse eigene Agenden in der Öffentlichkeit zur Schau getragen werden. Ein Aufmarsch Homosexueller, die den Anlass zur Anprangerung der Tatsache nutzen, dass ja anscheinend ein schwuler Kaiser mit allen Staatsehren bedacht wird, während in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft Homosexuelle immer noch wie der letzte Dreck behandelt werden, wird jedoch nicht gern gesehen. Deutschland wächst zusammen, heißt es über das Voice-Over von Helmut Kohl. Eine PR-Aktion für die Wiedervereinigung. Die feindliche Übernahme als große Versöhnungsinszenierung.
Abstecher ist ein großer Film. Nicht nur das Pendant zu den bestimmenden Fernsehbildern aus der Nachwendezeit, sondern im Grunde zu einem Film, wie ihn sich jeder Staatschef wünscht. Zur Propaganda der herrschenden Staatsmacht, zu einem Werk wie Leni Riefenstahls Triumph des Willens (1935), verhält sich Ulrich Weiß‘ Abstecher wie die notwendige Ergänzung, der unliebsame Bruder, das schwarze Schaf. Er ist eine gnadenlose Abrechnung mit der Wiedervereinigung und ihren Folgen, die die Abhängigkeit des Einzelnen von einer kollektiven Idee veranschaulicht. Wunsch und Realität liegen in der neuen BRD ebenso weit auseinander wie in der ehemaligen DDR. Die Möglichkeit für eine neue Gesellschaft, für eine neue Form des Miteinanders, wurde nicht wahrgenommen. Weiß ist bitter, denn die Realität ist bitter. Im Grunde hätte ’89 auch Krieg sein können. Der Sieger schreibt die Geschichte.
Vielleicht wird Abstecher von einer zukünftigen Kulturpolitik einmal als Beweis angeführt werden, dass es „damals“ ja auch andere, „kritische“ Stimmen gegeben hätte. Der Zuschauer wird sich jedenfalls, wie immer, auch dazu seine eigenen Gedanken machen müssen.
Abstecher – Deutschland 1992 – 65 Minuten – Regie und Drehbuch: Urich Weiß – Produktion: Andrea Hoffmann, Tony Loeser – Kamera: Johann Feindt, Eberhard Geick – Musik: Peter Rabenalt – Schnitt: Petra Heymann – Darsteller: Bewohner des wiedervereinigten Deutschland
Bildquelle: Bundesarchiv, Bild 183-1989-1104-437 / Settnik, Bernd / CC-BY-SA
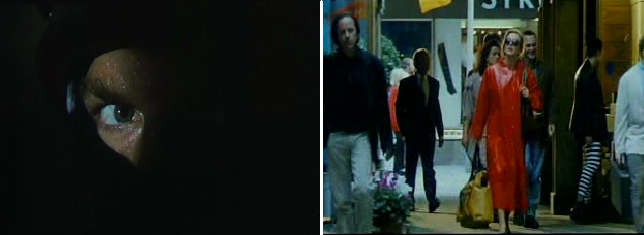
Ein Politthriller als Geistergeschichte. Die Figuren sind Schatten in einem unübersichtlichen Geflecht aus Politik, Polizei und organisiertem Verbrechen. Sie treten unvermittelt aus dem Dunkeln ins Bild und verschwinden dort wieder ebenso gleitend, sie sprechen aus dem Off, nachdem die Kamera sie nur flüchtig erhascht hat, flüstern, raunen sich im Vorbeigehen Vertrauliches zu, sind nur verrauschte Stimmen aus Funkgeräten, Telefonen oder von Tonbändern. Ein knallroter Regenmantel…
Es ist Zwischenkriegszeit. Der Kalte Krieg ist vorbei, BRD und DDR sind untergegangen, aber die „Berliner Republik“ hat noch nicht wirklich begonnen. In dieser Übergangsphase hält das organisierte Verbechen Einzug in die Politik, werden hinter Glasscheiben in den Konferenzzimmern die Anteile am neuen Land verkauft. Ein Trümmerfilm aus dem Jahr 1994.
Beschützt werden die Gespenster hinter den Glasscheiben vom SEK. Die Männer sind selbst Phantome, sie tragen Decknamen und Sturmhauben, bei denen nur die Augen als letztes Zeichen von Persönlichkeit hervorblitzen. Die Welt dieser Männer, ihre Rituale, ihr (brüchiger) Zusammenhalt sind wichtiger Teil von DIE SIEGER. Einer von ihnen, Heinz Schaefer ist ein Phantom aus der Vergangenheit – vor vier Jahren soll er sich umgebracht haben, doch Karl Simon erkennt ihn bei einem Einsatz gegen Geldfälscher wieder. Simon und Schaefer arbeiten beide für den Staat und sind doch Gegner in einem Dickicht aus V-Männern und machtpolitischen Grauzonen, sind Gehetzte, Zerrissene. Gesellschaftliches, Berufliches und Privates sind untrennbar, der Riss durch die Männer reicht tief in die Familien.
Oft wird DIE SIEGER als deutscher Actionfilm verkauft, dabei steht er eher in der Tradition der Polizeifilme von Lumet und den Mafiafilmen von Damiani. Doch Deutschland ist nicht Italien – die Mechanismen der Korruption laufen subtiler ab, vielleicht kann man ihnen nur mit Fantasie beikommen. Selten hat Grafs visueller Stil so gut zu einem Sujet gepasst, die unruhigen Kamerafahrten, die hektischen Zooms auf die Figuren, als ob er nach ihnen greifen, ihre Undurchsichtigkeit erfassen wollte. Genre heißt hier im Gegensatz zu vielen deutschen Filmen der 90er auch nicht der Wunsch möglichst amerikanisch auszusehen. Materiell ist der Film tief in der Bundesrepublik verhaftet: den Autobahnen und Raststätten, dem ICE und den Einkaufsmeilen, den Düsseldorfer Reihensiedlungen und den Vorstadtvillen. Hinter dieser materiellen Gegenwart lauern unterirdisch die Gespenster der Vergangenheit, der Terrorismus und sein politischer Mißbrauch. Sehnsüchte werden wach, nach DIE MACHT DES GELDES, dem Film den Graf nach dem Buch von Christoph Fromm über die Herrhausen-Entführung drehen wollte.
Das Ende des Traums vom deutschen Genrekino soll DIE SIEGER gewesen sein. Dass der Film gescheitert ist, darin schienen und scheinen sich fast alle einig zu sein: das Publikum, das ihn mied, die Kritik, die ihn nie bedingungslos liebte und auch Graf selbst – nach vielen Eingriffen ins Drehbuch.
Aber das Schöne am Kino ist, dass die Produktionsgeschichte irgendwann zurücktritt und es kein „hätte, könnte, sollte“ mehr gibt. Und der Film beginnt ein Eigenleben in den Köpfen der Zuschauer zu entwickeln, das weder der Regisseur mit seiner Vision noch die Filmbürokraten mit ihrem Kommerzstreben so vorhersehen können. Es ist wie bei Ciminos HEAVEN’S GATE, wo die Träume zu groß werden fürs Kino, wo nur noch Spuren, Bruchstücke, Ahnungen davon auf dem Zelluloid zurückbleiben. Doch Unvollkommenheit heißt auch immer Unabgeschlossenheit und damit: Offenheit. Eine Einladung mitzuträumen.
Der Traum vom deutschen Genrekino, so viel zu groß er manchmal auch scheinen mag, ist jedenfalls noch lange nicht ausgeträumt.
Die Sieger – Deutschland 1994 – 130 Minuten – Regie: Dominik Graf – Drehbuch: Günter Schütter – Produktion: Günter Rohrbach, Christoph Holch – Kamera: Diethard Prengel – Musik: Dominik Graf, Helmut Spanner, Loy Wesselburg – Darsteller: Herbert Knaup, Katja Flint, Hannes Jaenicke, Heinz Hoenig, Meret Becker, Natalia Wörner, Thomas Schücke.
Screenshots: © Eurovideo
DELLAMORTE DELLAMORE war für mich der erste Film, den ich von Michele Soavi gesehen habe, sieht man von seiner Dokumentation über die Filme seines prominenten Förderers Dario Argento ab. Und was für ein Fest war dieses herrlich verschwurbelte Meisterwerk doch!
Schon nach den ersten Minuten des Film ist klar, es handelt sich gar nicht in erster Linie um einen Zombiefilm, wie viele Online-Reviews glauben machen, auch nicht um einen Horrorfilm im eigentlichen Sinne. Der Friedhof aus dem Gruselbilderbuch, der Assistent des Friedhofswärters, der stark an Tor Johnson in Ed Woods unvergesslichem Trashmeilenstein PLAN 9 FROM OUTER SPACE erinnert und nicht zuletzt Dellamortes (Rupert Everett) ausgestellte Coolness stellen von Anfang an klar: Der Film ist ein postmodernes Spiel mit Klischees und Zitaten, an denen der Film wahrlich keinen Mangel hat. Leider kenne ich das italienische Genrekino zu wenig um etwaige Anspielungen zu erkennen, aber zumindest Hitchcocks VERTIGO dürfte wohl zu den Lieblingsfilmen von Soavi gehören und ein paar Klassiker der phantastischen Malerei wie Magrittes KUSS und Böcklins TOTENINSEL verwurstet er auch in das dennoch vollkommen originelle und immer aufs Neue überraschende Potpourri aus Einfällen, das mal an Tim Burton, mal an schwarzhumoriges dänisches Popkino und wahrscheinlich an zahlreiche mir unbekannte italienische Genrefilme anklingt.
Auf dem Friedhof der italienischen Kleinstadt Buffalora kommt der ein oder andere Tote schonmal nach sieben Tagen als Wiedergänger zurück. Doch das ist alles nicht so schlimm, den Friedhofswärter Francesco Dellamorte (Mädchenname der Mutter: Dellamore!) und sein scheinbar debiler und ziemlich aufgeschwemmter Helfer Gnaghi (François Hadji-Lazaro) haben schon lange eine Routine darin entwickelt, den lästigen Untoten mit Pistole oder auch rudimentärem Spatenende den Schädel zu zertrümmern, um ihnen so endgültig die wohlverdiente Sargruhe zu verschaffen. Kompliziert wird es für die beiden mit dem Tod so gut vertrauten Männer, als die Liebe in ihre in sich geschlossene Welt genießerischer Morbidität tritt. Eine rätselhafte Fremde mit nekrophilen Neigungen (Anna Falchi), scheinbar eine um ihren viel älteren und erst kürzlich verstorbenen Mann trauernde Witwe, verdreht dem Gerüchten im Dorf zu Folge impotenten Friedhofswärter den Kopf, während Gnaghi vom vorlauten Töchterlein des Bürgermeisters (Fabiana Formica) derart angetan ist, dass er sie vor lauter Nervosität erstmal so richtig vollkotzt. Doch das ist alles erst der Anfang einer Folge von immer groteskeren Ereignissen, die sich in ihrer Unfassbarkeit ständig zu überteffen scheinen und den Zuschauer von einem hysterischen Lachanfall in den nächsten stürzen, und das nicht ohne, dass man dabei auch noch echte Anteilnahme am Schicksal der Antihelden nimmt und sich fast unmerklich poetische und philosophische Elemente in den frei dahinfließenden Film flechten.
Die Handlung tritt denn auch vor den vielen herrlichen Einfällen und den liebevoll gezeichneten Haupt und Nebenfiguren zurück. Ob Glühwürmchen, die eher wie riesige blau brennende Papierkügelchen an schön sichtbaren schwarzen Fäden (2. Anspielung auf PLAN 9?) wirken, über den dick eingenebelten und von knorrigem Astwerk überwucherten Friedhof schweben, ob der Bürgermeister, die bei einem Motorradunfall entstellte Leiche seine Tochter für seine Wahlkampagne fotografieren lässt oder ob sich wieder die reguläre Friedhofsbesuchern Signora Chiaromondo (Claudia Lawrence) zum Stelldichein mit den Toten einfindet – ein gewisser General bringt ihr nämlich immer eine Flasche Sambuca mit – das Herz aller absurdiitäts- und surrealismuslüsternen Zuschauer wird verwöhnt. Ein quasselnder abgetrennter Kopf in der Ruine eines Fernsehers und eine Horde von Pfadfinderzombies verleihen dem Ganzen nochmal so richtig Pep, während Dellamorte ab und an bedeutungsschwangere Dialoge mit dem Tod persönlich führt und in diversen Formen von seiner großen toten wahren Liebe heimgesucht wird. VERTIGO lässt grüßen.
DELLAMORTE DELLAMORE gehört zu jenen Filmen, die auf wunderbare Weise ziel- und richtungslos dahinmäandern und sich schließlich zur breiten Mündung ins Meer der Assoziationen öffnen, in dem zumindest einige von uns Cinephilen doch nur zu gerne planschen. Ohne zu viel zu verraten kann gesagt werden, dass das Twist-Ende dem ganzen nochmal einen wundervollen Hauch romantischer Ironie verleicht und ein bißchen an das Meisterwerk der Gebrüder Quay INSTITUTE BENJAMENTA erinnert.